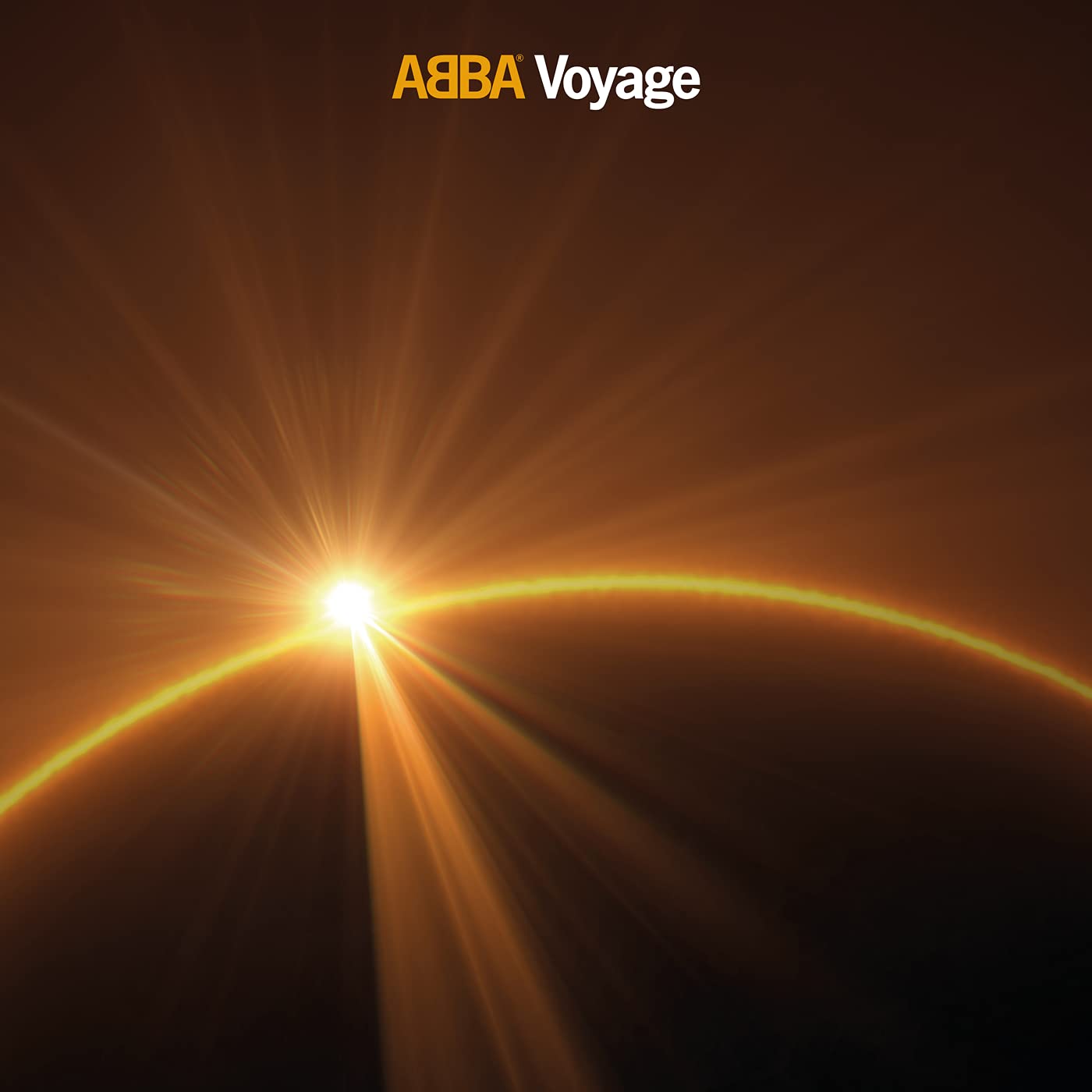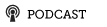An diesem 3. Mai und spaziere ich von einem Spezi beschwingt bei untergehender Sonne durch das warme Friedrichshain und freue mich, dass Berlin mir so wohl gesonnen scheint: Ich habe noch eine Konzertkarte für mein “Album des Monats” ergattert und das Leben ist schön. Kurz vor dem Berghain begegnet mir ein Fuchs, der mich neugierig anguckt und dann im Gebüsch verschwindet – ein erster Hinweis darauf, dass auch der Rest des Abends eher wild und mystisch wird. Das Konzert findet jedoch nicht im Berghain selbst statt, sondern in der daneben gelegenen Kantine, die man mit ihrer von der Decke hängenden Tapete und dem Kachelofen im Foyer als familienfreundlich-rustikal bezeichnen könnte. In den Rezensionen eines großen Internetportals bezeichnet ein Nutzer die Kantine als die beste Konzertlocation Berlins, eine Einschätzung, der ich eingeschränkt zustimmen würde. Für U.S. Girls ist es wohl die perfekte Größe, denn das Konzert trägt den erfreulichen Zusatz “AUSVERKAUFT”.
Supportact an diesem Abend ist die (Wahl-)Berlinerin Discovery Zone, die ich hier nur erwähne weil es wirklich, wirklich wichtig ist. Hinter dem Namen steckt das Soloprojekt des Fenster-Gründungsmitglieds JJ Weihl, die mit einem Kaleidoskop um den Hals ganz allein auf der Bühne steht und Musik spielt, die wie eine Mischung aus Annie Hart und Depeche Mode klingt. Neben Laptop und Gitarre kommt auch eine Loopstation zum Einsatz, in die unter anderem ihre gehauchten “Thank You”s eingespielt werden und mit dem verhaltenen Klatschen des Publikums in den Pausen zwischen den Songs widerhallen. Wie sie das damit das unangenehme Gefühl, das einem völlig unbekannten Supportact innewohnt, zurück aufs Publikum überträgt, dürfte wohl der größte Geniestreich des Abends bleiben. Nebenbei ist ihre Musik auch äußerst tanzbar und es gab nicht ein-, sondern mehrere Thereminsoli zu bestaunen, womit der Auftritt endgültig perfekt war.
Als U.S. Girls dann endlich die Bühne betreten, kommen erstmal die sechs Instrumentalisten – übrigens durchwegs Männer – auf die Bühne und verharren dann, vom Applaus ungerührt, in Startposition. Erst eine halbe Minute später schleichen Sängerin Meghan Remy und ihre Backgroundsängerin gebückt auf die Bühne, sich gegenseitig stützend. Beinahe verängstigt blicken sie ins Publikum, als seien sie Beute, die von den hungrigen Augen der Zuschauer schon zerfleischt wird. Wortlos beginnt die Band zu spielen, und es offenbart sich eine weitere Komponente des Remyschen Perfektionismus, denn alle Instrumente sind perfekt aufeinander eingestellt und man kann selbst die kleinsten Details aus den Lautsprechern heraushören. Wie in Studioqualität abgespielt erklingt die Musik, ein Eindruck der auch dadurch verstärkt wird, dass bis “Incidental Boogie” die Songs in der selben Reihenfolge wie auf dem neuen Album kommen. Auch die Bühnenshow ist einfach, aber perfekt passend gestaltet, indem einfach darauf verzichtet wird. Die Musiker, die im düster-blauen Licht stehen, stehen somit auch völlig im Mittelpunkt.
Während die Stücke natürlich grandios sind, weichen U.S. Girls von ihrem etwas klinischen Präzisionskurs leider erst ab, als älteres Material der Alben Half Free und Gem präsentiert wird. “Sororal Feelings” bekommt eine unheimliche Note, als eine geisterhafte Tonbandstimme immer wieder im Hintergrund “Don’t Tell Women What To Do” ansagt, wenige Songs später brechen Gitarrist und Saxophonist in ein brachiales Solo aus, das Remy dazu bewegt, sich die Ohren zu zuhalten und wieder mit ängstlichem Blick auf der Bühne zusammenzusinken. Die schwache Frau im Kreis der mächtigen, lauten Männer ist der schauspielerisch überspitzte Höhepunkt eines Sets, das eben nicht nur textlich gegen das Patriarchat wettert.
Der letzte Song ist erwartungsgemäß “Time”, in dem alle Instrumentalisten nochmal die Chance nutzen, ihr virtuoses Können vorzuzeigen. Dementsprechend lärmig gestaltet sich der achtminütige Dancefloor-Kracher, verstärkt durch die mit dem Keyboarder zum Trio gewachsene Mikrophonfraktion, die gegen Ende wiederholt “there is no time – tell them there is no time!” proklamiert. In Anbetracht dessen sollte der Song eher “Time’s Up” heißen, aber die Botschaft des Abends dürfte mittlerweile eh jeden erreicht haben. Remy blickt noch einmal drohend ins Publikum und schleicht dann gebückt zurück in den Backstage. Die letzten Takte verhallen kurz darauf und zurück bleibt ein euphorisch-gerührtes Publikum, das lange Beifall spendet und dann, nach kurzem Zögern, (aber keiner Zugabe) in die Berliner Abendluft hinausströmt. Aller Ernsthaftigkeit auf der Bühne zum Trotz bleibt ein freudiges Gefühl.