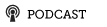Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen
Father John Misty – I Love You, Honeybear
Wie beschreibt man sein Innerstes, ohne dabei narzisstisch und im schlimmsten Fall kitschig zu wirken? Father John Misty aka Josh Tillman hat auf I Love You, Honeybear einen Weg gefunden.
Obwohl der Albumtitel noch nach Zuckerwatte und Schmalz schreit, lässt Tillman im gleichnamigen Eingangstrack diesen Eindruck schnell wieder in sich zusammenstürzen: Während die Band sich zu orchestralen Höhen aufschwingt, schmettert Tillman “Mascara blood ash and cum/ on the Rorschach sheets where we make love“ über das Getöse, und verwandelt den Song in ein apokalyptisches Liebesbekenntnis zu seinem Honeybear. Honeybear, das ist seine Ehefrau Emma, und ihre Beziehung zueinander das zentrale (wenn auch nicht das einzige) Thema des Albums. Tillmans Blick richtet sich dabei mal schmachtend, mal eifersüchtig und zuweilen auch kritisch auf seine Frau, wobei seine Kritik allerdings eher lustig ausfällt. Ernster und fast zynisch wird es, als er sich kurzzeitig von der Liebe ab- und der Gesellschaft zuwendet: “Bored In the USA” ist einerseits eine grandiose Springsteen-Anspielung, andererseits eine beißende Abrechnung mit der amerikanischen Gesellschaft. Als der Protagonist des Songs feststellt, wie schlecht es um ihn bestellt ist, und dass ihm nur die Langeweile bleibt, ertönt im Hintergrund Gelächter aus der Konserve – ein Humor so böse, dass selbst die Zuschauer in Lettermans Late Show kurz unsicher waren, ob sie dafür applaudieren sollen. Das Album endet mit “I Went To The Store One Day”, in dem Tillman seine Wandlung zum Ehemann beschreibt und schließt mit den ersten Worten, die er mit seiner Frau gewechselt hat: “Seen you around, what’s your name?”.
Anspieltipps: „I Love You, Honeybear“
Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen
Vierkanttretlager – Krieg und Krieg
Vierkanttretlager klingen auf Krieg & Krieg um einiges wütender als auf ihrem Debütalbum Die Natur greift an. Bereits im gleichnamigen Opener wird klar, dass die Herren nicht auf Harmonie aus sind. Frontmann Max Leßmann inszeniert im dritten Lied „Blumenkränze und Applaus“ eine moderne Jesusfigur, deren Leidensgeschichte sich in den nachfolgenden Songs offenbart: Auch nach mehreren verzweifelten Versuchen erfährt der Protagonist doch keine Liebe. Mit dem persönlichen Unglück konfrontiert, entdeckt die Figur in allen Irrungen und Wirrungen schließlich das Schweigen für sich. In einem finalen Abgesang auf die Welt findet sie dann doch noch den lang ersehnten Seelenverwandten, um im letzten Lied mit ihm gemeinsam in Stille aufzugehen. Beeindruckend an Krieg und Krieg sind erneut Leßmanns Texte. Wie schon auf dem Debüt gelingt es ihm, persönliche Begebenheiten auf eine universelle, die menschliche Natur beschreibende Ebene zu heben. Dazu bietet Krieg & Krieg einen so vielseitigen Sound, wie man ihn von der Band nicht erwartet hätte. Besonders deutlich wird dies am groovenden „Lass uns den Verstand verlieren“, sowie am Spiel von Gitarrist Christian Topf, der in beinahe jedem Stück mit einem anderen Gitarrenklang aufwartet. Die musikalische Weiterentwicklung des rauen, ungeschliffenen Indierock des Debütalbums ist dabei unüberhörbar. Weil dieser Sound aber so wunderbar zu Vierkanttretlager und ihrer norddeutschen Heimat Husum passte, darf man hoffen, dass sie auf ihrem dritten Album zumindest ein wenig zu diesem zurückzukehren, statt sich womöglich in weiteren Soundexperimenten zu verlaufen. Vermeiden sie diesen „Fehler“, haben wir es hier mit einer der wichtigsten deutschsprachigen Bands der nächsten Jahre zu tun. Krieg & Krieg ist ein großer Schritt dorthin.
Anspieltipp: „Der letzte Satz der Welt“ & „Krieg und Krieg“
Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen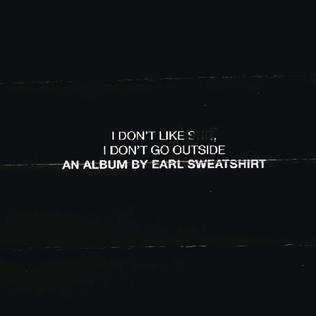
Earl Sweatshirt – I Don’t Like Shit I Don’t Go Outside
Im strömenden Rap-Regen des letzten Halbjahres ist euch eine Platte vielleicht nicht zu Ohren gekommen – das soll sich jetzt ändern. I Don’t Like Shit I Don’t Go Outside ist Earl Sweatshirts zweites Album und hält das bereit, was der Titel verspricht – ein Defilee von Null-Bock, Emotionslosigkeit und gleichzeitiger Aggression. Es ist wie ein großer Joint, der verschiedene Geschmacksknospen beim Hörer bedient. Mal bitter, mal sauer, aber irgendwie auch süß. Das „Drehen“ von ebenjenem hat Earl Sweatshirt alias Thebe Nerude Kgositsile mit nur 15 Jahren in der Odd Future Formation perfektioniert, nachdem ihn kein geringerer als Tyler, the Creator entdeckte. Musikalisch entwickelte sich der noch junge Wortakrobat über die Jahre in eine andere Richtung weiter. Während das Debüt Doris (2013) melodisch eingängig und als perfekt durchkomponiertes Kunstwerk daherkam, ist bei dem Nachfolger ein Alterungsprozess erkennbar. Das Album ist rauer, ehrlicher, wirkt fast willkürlich und dadurch selbstsicher und erwachsen – Earl Sweatshirt muss sich nichts mehr beweisen, er ist bereits ein Meister des Sprechgesangs. Die selbst produzierten Beats entspannen und rauschen, um plötzlich in arrhythmische Snares und aufdringliche Synthies umzuschlagen. Das Hin und Her spiegelt sich in seinen Texten wieder, welche in Odd Future Manier dunkel und hier besonders erdrückend, depressiv, aber auch mal ironisch sind. Die Variation äußert sich zudem im Tempo der Raps, welches von verträumt benommen bis hin zu schnelleren Lines variiert. Dieses Album ist nichts für den lässigen Kopfnicker oder Bootie-Shaker. Es ist wie ein großer Joint. 10 Titel, 30 Minuten und der Trip ist schon wieder vorbei. Aber intensiv war er.
Anspieltipp: „Grief“
Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen
Benjamin Clementine – At Least For Now
Mit 20 Jahren flüchtet Benjamin Clementine aus London, weil es nichts als Enttäuschungen für ihn bereithielt. Schwelgend in einer romantischen Vorstellung von Paris, sucht er blauäugig dort sein Glück. So landet er obdachlos auf der Straße und besingt gegen Hutspende die Pariser Metro. Sein großes Talent spricht sich jedoch schnell rum und von einem begabten Clochard wird Clementine zum professionellen Musiker mit Plattenvertrag. Ebenjene Geschichte gepaart mit seiner Musik und seinem Auftreten sind so kohärent, dass es fast fiktiv scheint. Doch nur solange bis sein Piano ertönt. Überaus emotional setzt er seine voluminöse Stimme mal kraftvoll, mal sanft ein und verschmilzt furios mit seinem Instrument. Sein Tenor reicht in die hohen Register; er setzt das Falsett ein und lässt die Hörer zeitweilig im Glauben, eine weibliche Stimme zu hören. Hier und da zeigt die Musik von Clementine ihre theatralische, fast sakrale Ader, ohne dabei aufgeblasen oder belehrend zu sein. Der junge Pianist lässt sich neben seiner eigenen Stimme nur noch von Streichern und Schlagzeug begleiten. Dadurch verzahnen sich große Emotionen mit einfachen Mitteln in ein hervorragendes und ehrliches Debütalbum. Denn auf At Least For Now ist Clementines Authentizität seine größte Stärke. Irgendwo zwischen Chanson, Jazz und Kammerpop entspringt sein Stil der exklusiven und großspurigen Vorstellung der Hochkultur. Bescheiden und barfuß setzt sich Clementine an sein Piano und bringt das Publikum zum Schweigen.
Anspieltipp: „ London“
Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen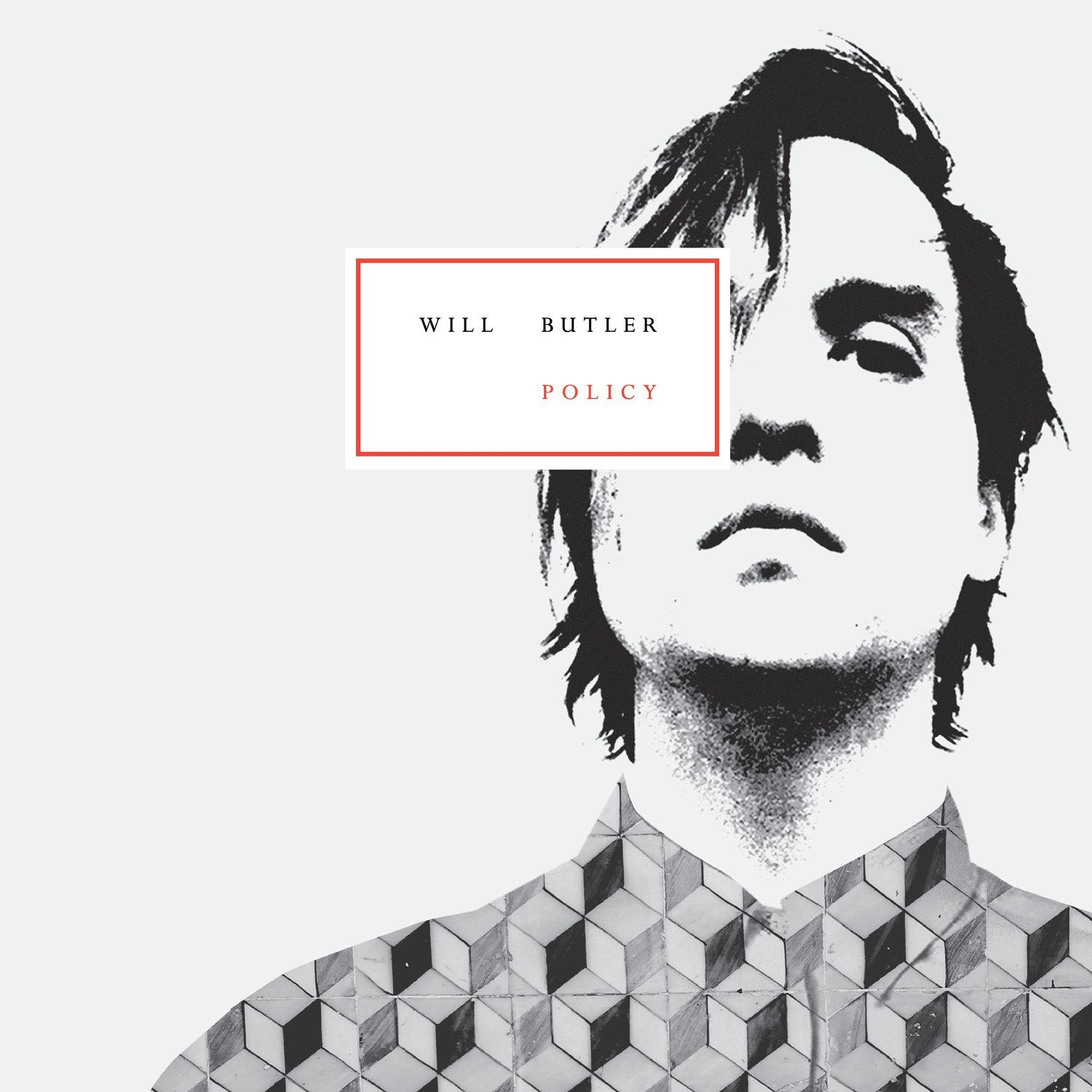
Will Butler – Policy
Die griechische Schuldenkrise oder IS-Kämpfe: Als Promotion für sein Album Policy hat Will Butler jeden Tag eine Schlagzeile für die Tageszeitung The Guardian vertont. Ein schlauer Trick, um das Album mit dem Titel „Policy“ durch aktuelle Geschehnisse in den Fokus zu rücken. Und das, obwohl keiner der von Butler improvisierten Songs auf dem Album tatsächlich zu finden ist. Policy ist das erste Solo-Album des Bassisten der Band Arcade Fire. Bis auf das Schlagzeug und die Bläser-Elemente hat Butler bei den Aufnahmen alle Instrumente selbst eingespielt. Innerhalb einer Woche wurden so acht komplett unterschiedliche Songs produziert: Den Beginn des Albums leitet mit „Take My Side“ eine schnelle Garagenrocknummer ein. In „Finish What I Started“ hingegen wird es ruhiger. Butler setzt hier statt Gitarren auf sanfte Klavierklänge. In anderen Songs stellt der Synthesizer ein dominantes Instrument dar. Es prasseln unsagbar viele musikalische Eindrücke auf den Zuhörer ein – und das in nur 30 Minuten Spielzeit. Doch trotz der abwechslungsreichen Instrumentalisierung wirkt Policy auf keinen Fall zerrissen. Butler führt mithilfe vieler Feinheiten immer wiederkehrende Schemata ein. Dazu gehört auch der groovige 80s-Klang, der die Songs herrlich tanzbar macht, und wohl auch dem Indie-Mutterschiff Arcade Fire gut zu Gesicht stände. Butler vermittelt auf Policy übrigens genau das, was der Titel schon vermuten lässt: Seine eigene Ansicht zum momentanen Weltgeschehen. Zwar allgemeiner als in der Promo-Aktion bei The Guardian, aber dafür wesentlich besser durchdacht, weniger improvisiert und eingängiger.
Anspieltipp: „What I Want“
Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen
Courtney Barnett – Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit
Wenn man Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit zum ersten Mal hört, kann man sich gut vorstellen, dass Courtney Barnett dies häufiger genau so macht. Womöglich genau auf dem Stuhl, der, wenn auch ein bisschen wackelig auf den Beinen, das Cover ihres Debüts schmückt. Auf der Platte besingt Barnett kleine Geschichten aus dem ziellosen Leben einer Mittzwanzigerin, die in den meisten Fällen realen Begebenheiten entwachsen sind. Ein teils gelangweilter, teils monotoner Sprechgesang gibt Barnetts Musik dieses gewisse Etwas, und zwar nicht, indem er durch das Geklimper einer folkigen Holzgitarre begleitet wird, sondern von lauten und schroffen, grungigen Riffs, die auch gerne mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Wider Erwarten entsteht aus diesen gegensätzlichen Elementen ein sowohl stimmiges, als auch melodisches Endergebnis mit Wiedererkennungswert.
Die Alltagslyrik der Songs und Barnetts innere Monologe sind authentisch und sympathisch. So beispielsweise auch die Geschichte des zwanzigjährigen Oliver Paul im Song “Elevator Operator”, der kurzerhand beschließt nicht mehr zu arbeiten und stattdessen Cola-Dosen im Park aufeinanderstapelt. Trotz dieser textlichen Banalität verkörpert Barnett nicht das naive, niedliche Mädchen von nebenan. Durchschnittlicher Sex, die Vorzüge von Bio-Lebensmitteln, und ausgestopfte Kängurus gehören zu der Realität, die sie schildert und die zunächst äußerst leichtfüßig daherkommt, nicht jedoch ohne einen bitteren Beigeschmack von Verzweiflung. Nie wurde der Alltag, den wir lieben und hassen, den wir meistern und an dem wir scheitern, so charmant besungen wie durch Courtney Barnett.
Anspieltipp: „Pedestrian At Best“
Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen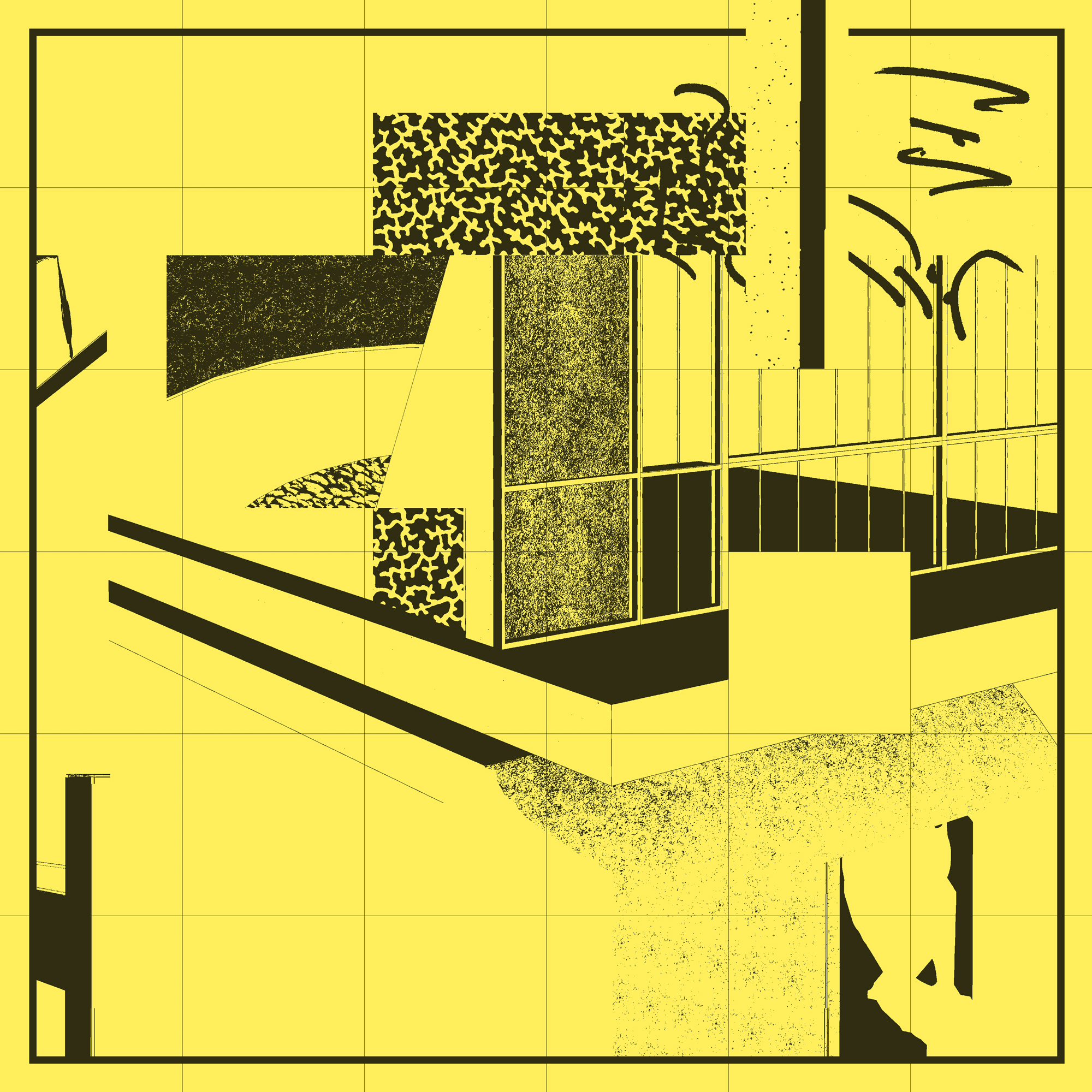
The Odd Couple – It’s A Pressure To Meet You
Produziert von Frank Popp haben die beiden Wahlberliner Jascha Kreft und Tammo Dehn ein Debutalbum aufgenommen, das die Attribute reduziert und redundant verdient. Die elf Songs sind eine abgeklärte und auf den Punkt gespielte Abhandlung der letzten 40 Jahre Rockmusik. Ausufernde Gitarrensoli werden wegrationalisiert und die Essenz des Sounds hervorgehoben. So kratzt das Gros der Songs gerade so an der Drei-Minuten-Grenze. Das Duo lässt 60’s Garagenrock, Psych-Pop, Stoner-Rock und Proto-Metal anklingen, ohne aufgesetzt zu wirken. Es geht eher um klare Strukturen, Authentizität und Understatement; wobei die zwei Jungs auf knapp 30 Minuten Spieldauer alles Packen, was eine gute Rockplatte braucht.
Anspieltipp: „25“
Mein Highlight des letzten Halbjahres
Weiterlesen
Unknown Mortal Orchestra – Multi Love
Im Vergleich zu dem vor zwei Jahren erschienenen Album II reduzieren Unknown Mortal Orchestra auf Multi-Love die Gitarren und geben stattdessen alten und selbst gebastelten Synthesizern viel Raum. Die aus Neuseeland stammende Psych-Pop-Band erzeugt so einen eingehenden und an den Funk der 70er Jahre angelehnten Groove, der ihrem früheren Image als Rockband widerspricht. Doch Ruban Nielson, Sänger und Kopf der Band, wirft mit diesem Album nicht alles Alte über den Haufen. Vielmehr bettet er die neuen Melodien in den psychedelischen und halluzinogenen Charakter ein, der bereits die ersten beiden Alben definierte. Die Aufnahmen im eigenen Kellerstudio prägen den experimentellen und detailreichen Sound, der die Geschichten von Nielson trägt.
Multi-Love ist ein Album über die Liebe. Doch es erzählt nicht die ewig gleiche Geschichte des Kennenlernens, Liebens und Auseinanderbrechens. Bereits der Titel und gleichnamige Opener verraten, was Nielson nächtelang in seinem Kellerstudio, welches zeitgleich das Albumcover ziert, zu verarbeiten hatte. Wieder einmal wurde es sein ganz persönliches vertontes Tagebuch und Zeilen wie „Multi-Love has got me on my knee / We were one, then become three“ erzählen die Geschichte eines emotionalen Kampfes, einer verwirrenden und polyamorösen Dreiecksbeziehung, die Nielson und seine Ehefrau mit einer jungen Frau eingingen. Mit seinen Disco-, Soul- und R’n’B-Klängen zelebriert Multi-Love auch die mitunter auch negativen Erfahrungen der letzten zwei Jahre und schlägt somit einen optimistischeren Weg als der Vorgänger II ein, durch welches sich ein depressives Gefühl von Einsamkeit durchzog.
Anspieltipps: „Multi-Love“ & „Can’t Keep Checking My Phone“