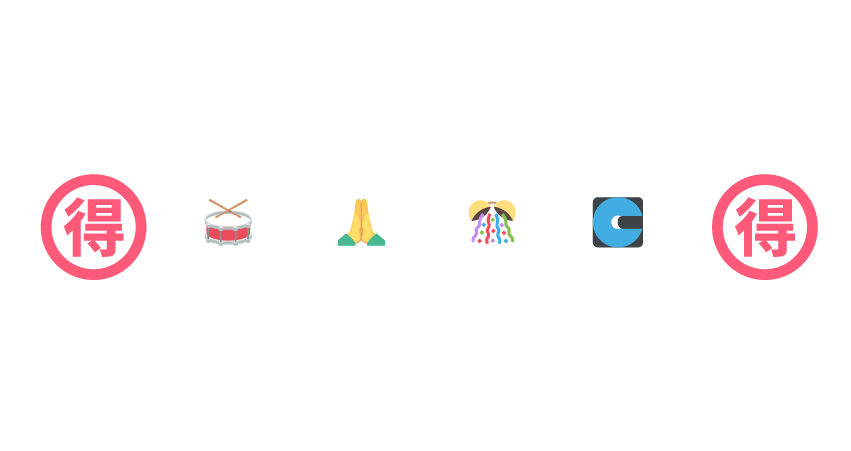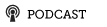Florence and the Machine - High As Hope
Weiterlesen
Die Märchenstunde ist vorbei: Florence Welch verlässt die düster mystischen Erzählungen ihrer ersten Alben und greift tief in ihre alten Tagebücher, um uns ihre Jugendgeschichten zu offenbaren. Während Welch uns in Lungs (2009) und Ceremonials (2011) mit dunkler Magie und fantastischen Fabeln bezauberte, scheint die Künstlerin nun einen neuen Kurs einzuschlagen.
How Big, How Blue, How Beautiful hatte schon den thematischen Übergang zum neuen Album angedeutet: In dem Album von 2015 handelten Lieder von Hollywood und Heiligen, 2018 geht es weiter mit biblischen Erzählungen gepaart mit Jugendsünden.
„South London Forever“ ist wie ein Auszug aus dem Tagebuch der jugendlichen Florence. Ihre bösen Geister sind keine übernatürlichen Wesen mehr, es sind Magersucht und Drogen. In Zusammenarbeit mit Kamasi Washington am Saxophon bekommt der Song „South London Forever“ einen ganz neuen musikalischen Touch, der sich von der FatM-typischen Harfe distanziert.
„Big God“ und „Patricia“ sprechen Glaubensfragen an, wobei „Patricia“ auch eine Hymne an Pattie Smith ist. „Big God“ versucht sich an einer neuen Richtung, beeinflusst von Jamie xx, der das Lied mitschrieb.
In der mächtigen Ballade „Grace“ möchte sie sich bei ihrer kleinen Schwester nach langer Zeit entschuldigen und schafft es, im Refrain den Zuhörer mitzureißen- nicht zuletzt auch dank Sampha am Klavier.
High As Hope ist voller Reue und Melancholie, ein reflektierendes Werk der Künstlerin, aber eben auch voller Hoffnung für die Zukunft.
Anspieltipps: Grace & South London Forever (Spotify)
Beach House - 7
Weiterlesen
Sieben Studioalbum und 77 Songs haben Beach House mit Abschluss ihres neuesten Opus 7 geschaffen, insofern lag es für Victoria Legrand und Alex Scally nur nahe, auch den Albumtitel mit der mystischen Zahl zu verknüpfen. Trotz kritischer Stimmen, die der Band bereits vor den Veröffentlichungen ihrer Quasi-Doppelalben Depression Cherry und Thank Your Lucky Stars vorgeworfen hatten, immer dasselbe zu machen, wird der eigenen Linie treu geblieben und am „signature sound“ wenig verändert, außer eben, dass es wieder ein bisschen besser und voller als zuvor klingt. Produziert mit dem Texaner Sonic Boom (welch verheißungsvoller Name!), hat die Band ihre Songs dieses Mal in gleich fünf Studiosessions ersonnen, um die Zeit zwischen Idee und Fertigstellung eines Songs so kurz wie möglich zu halten und, so der Plan, sich keinen Einfall durch die Lappen gehen zu lassen. Dabei klingen sie trotzdem nicht, als wäre zu wenig aussortiert worden:
Das stürmische und für einen Beach House-Track überdurchschnittlich rasante „Dark Spring“ bricht als Albumeinstieg über den Hörer herein wie ein Wolkenbruch, der einen pudelnass zurücklässt. Trockener wird man in den Geisterbahn-Songs „L’Inconnue“ und „Black Car“ leider auch nicht, deren Gruselfaktor gut in David Lynchs Roadhouse gepasst hätte und die Gott weiß warum ihre Angstschweißwirkung nicht im letztjährigen Twin Peaks-Revival beweisen durften. Visuell-mysteriös geht’s immerhin in den hypnotischen Begleitclips der Songs zu, die mit schwindelerregenden Mustern den Gehirn-Arbeitsspeicher des Zuschauers freiputzen. Gegen Ende von 7 überwiegt dann doch die bittersüße Melancholie in Songs wie „Woo“ oder „Last Ride“, wobei letzterer – wie immer bei Beach House! – einen bombastischen Albumabschluss markiert.
Platte für erscheinende Platte fragt man sich, wie man nach so langer Zeit im selben Soundgefilde noch so originell klingen kann. Nun ja, eines Tages werden sie schon noch scheitern, aber auf 7 ist das noch nicht in Sicht.
Anspieltipps: Dark Spring & Pay No Mind (Spotify)
Die Achse - Angry German
Weiterlesen
An wütenden Deutschen, die sich die Achse Berlin-Rom zurückwünschen, mangelt es derzeitig nicht. Bazzazian (Produzent von Haftbefehls „Anna Kournikova“) und Farhot („Chabos wissen wer der Babo ist“) drehen den Spieß um und bringen als „Die Achse“ mit Angry German die Antwort des multikulturellen Deutschlands auf rechte Wutbürger in ein musikalisches Gewand mit Trip-Hop- und Grime-Anleihen.
Auch wenn die Angry German EP nur auf 24 Minuten Spiellänge kommt, legt sie doch beachtliche Vielfalt an den Tag: „Hate You“ ist ein um ein brachialer Adrenalinkick, der einem zunächst den Inhalt der Stimm-Fetzen („Hate You!“) wie ein Mantra ins Bewusstsein einbrennt, um gegen Ende versöhnlichere Töne anzuschlagen und in melodischere Gefilde abzuschwenken. Auf „Anthem“ zeigt Die Achse, dass man aus nicht viel mehr als einem Producer-Tag durchaus in eine eingängige Hymne zimmern kann, sogar gescratcht wird hier – ganz allerliebst. Wer beim Titel der EP deutschsprachige Feature-Gäste befürchtet hat, kann unbesorgt sein: auf dem Titeltrack rappt der Brite Suspect und auf „Nicolas Cage“ steuert nicht nur der Grime-MC Ghetts, sondern auch Dancehall-Sänger Assassin (der auch schon von Kendrick Lamar gefeatured wurde) einen vorzüglichen Part bei, der von aggressiven Snare-Rolls unterlegt die Gemüter hochkochen lässt. Überhaupt hat die Soundästhetik der Achse wenig mit der des deutschen Zeitgeistes zu tun und klingt, wenn man denn überhaupt Bezugspunkte zu finden vermag, eher nach dem rauen Sound Londons. Erhalten bleibt der Signature-Sound auch auf den ruhigeren Nummern der Platte: „Patient“ wird von gedämpften Klaviertönen und orientalisch angehauchten Klängen geprägt; der Schlusstrack „Leave Me“ baut auf melancholischen Vocal-Samples auf, bricht völlig mit dem Konzept der Wut und wirkt stattdessen verletzlich. Damit schließt er den Spannungsbogen stimmig und lässt den Hörer gierend nach Mehr zurück.
Anspieltipps: Hate You & Nicholas Cage & Leave Me (Spotify)
Heisskalt – Idylle
Weiterlesen
Man kann es gar nicht in Worte fassen, wie sich vier Stuttgarter 2010 zu einer Pop-Rock-Formation zusammenfanden, nur um mit ihrer ersten EP 2011 schnell auf sich aufmerksam zu machen. Drei Jahre später erschien mit ihrem Debüt Vom Stehen und Fallen eine Alternative-Rock-Platte, die unterschiedlicher als die EP nicht sein könnte – mit Erfolg. Der Sound des ersten Albums wurde beim zweiten weiter verfeinert und stellt Heisskalts Interpretation des Post-Hardcores da. Vier Jahre, zwei weitere Studioalbum und ein Livealbum später, existieren Heisskalt quasi ohne Bassisten. Und auch ohne Lucas Meyer wurde Idylle zu einem eigenständigen und vor allem eigenwilligen Albumweiterentwickelt.
Idylle bewegt sich zwar immer noch irgendwo um Post-Hardcore herum, aber so ganz eindeutig ist das Genre nun nicht mehr. Noch weiter aufgebrochene Songstrukturen, dennoch gleichbleibende Rhythmen und Melodien, aber weniger verschachtelte Texte – was erscheint, als würde daraus nichts werden, wächst mit der Zeit zu einer ausdrucksstarken und fast schon erschreckend ehrlichen Platte heran. Alles wirkt nun näher am Musiker, näher an rohen Ideen, was unter anderem an der für Heisskalt befreienden Entscheidung lag, sich von ihrem Plattenlabel zu trennen. Ein gewagter Schritt, der die Musiker hoffentlich vorangebracht hat. Während es beim zweiten Album noch Aufschreie gab, dass es nicht mehr den Klang des ersten hatte, wird jetzt die Unzugänglichkeit kritisiert. Nur sehr wenige Refrains lassen sich auf Idylle finden, fast jeder Song grenzt durch seine Eingängigkeit an Monotonie und es sind gerade einmal neun Lieder auf der Platte. Die Monotonie nicht abstreitend, sehe ich es als willkommene Abwechslung, was Heisskalt veröffentlicht haben. Nicht nur bricht man mit der „Namenstradition“, wenn es überhaupt eine gab, auch musikalisch haben sich Heisskalt an Neuem versucht: statt vertrackte Songs mit Soundwänden aus ihrem Lieblingspedal, dem Boss DD-20, findet man nun zwei Bässe statt Gitarren im Titelsong wieder und im letzten Song greifen sie auf eine Akustikgitarre zurück, die dem sonst recht lauten Album einen Ruhepol gibt.
All das definiert Heisskalt nicht neu und macht Idylle nicht zum überragendsten Album ihrer Karriere, aber definitiv zum bisher einschneidendsten.
Anspieltipps: Bürgerliche Herkunft & Idylle & Wie Sterne (Spotify)
Croatian Amor - Body Of Water
Weiterlesen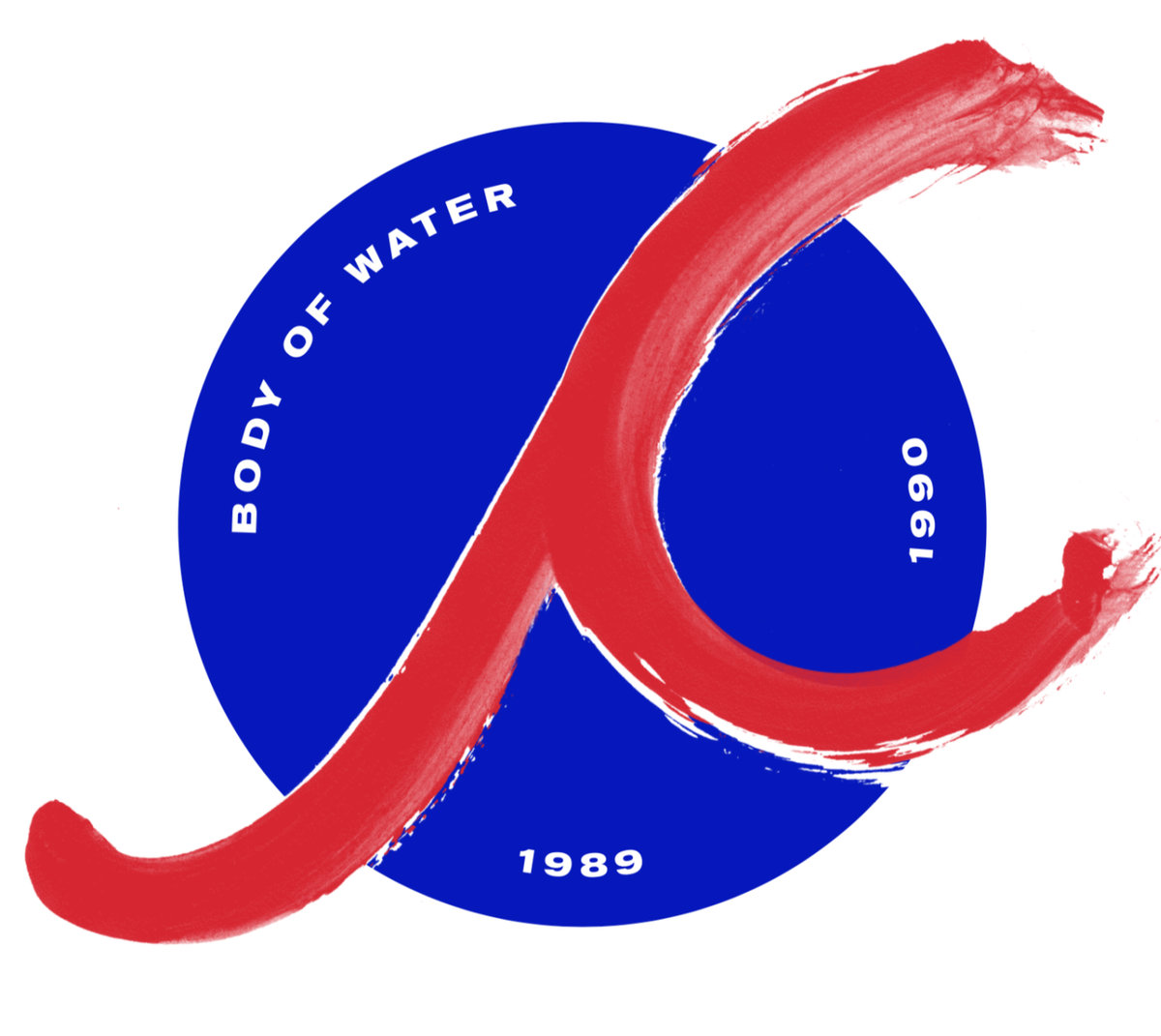
Loke Rahbek ist der beste Mensch aller Zeiten, bestreitet ja auch niemand, eh klar. Die frischesten Triebe seines stabil auswuchernden Soundgewächses versammeln sich unter dem Namen Body of Water und sind wie schon das Projekt Body Sculptures in Kollaboration mit der personifizierten skandinavisch-unterkühlten Technomoritat Varg ausgeschlagen. Wo Body Sculptures ihre programmatisch im Paratext anschwingende Beklemmungsmetaphorik allerdings bevorzugt in lichtscheues Dröhnwerk und Unheilsdräuen übersetzen, verbleibt Rahbek erneut dabei, sein Moniker Croatian Amor im selbstgeschaffenen Genrekämmerchen “Bubblegum Industrial” zu verhaften.
Der präsente und aufmerksamkeitsheischende Defätismus Rahbekscher Nebenspielwiesen wird hier also von einer unerschütterlichen Humanität überlagert, die die Musik des Dänen als subtile Zweitpräsenz in ihren kapillaren Tiefen beständig durchdringt. Hermetik und Abgründigkeit weichen auf Body of Water so einer fast naturalistischen, in Pastell gezeichneten Anmut: In “Shadows Show Violet” tastet sich ein zart lohendes Synthiegespann durch eine opake Unterwasserwelt und nimmt ihr ihre Bedrohlichkeit; “The Pearl (I Know You)” sprudelt euphorisch über und wirkt, als könne es Lebensenergie phonetisch übertragen; “12 Oysters on her Tail” ist der Popversuch von Body of Water, durch den Posh-Isolation-Restwelt-Wechselkursrechner gejagt fast ein bisschen Soul und legitimer Nachfolger von “Sky Walkers”; den Abschluss bildet “They Took Turns Lifiting One Of Their Own” und schummelt unter das EP-charakteristische Gleißen erstmals einen Beat, der wildere Gemüter durchaus zum Mitwippen einladen könnte.
Anspieltipps: – (Spotify)
DJ Koze - Knock Knock
Weiterlesen
Es gibt nichts Schlimmeres als einen Artikel mit den Worten zu beginnen, dass die Musik einen in eine andere Welt eintauchen ließe. Deshalb muss ich mir wohl als Einstieg etwas anderes einfallen lassen: „Klopf-Klopf“-Witze in Verbindung zu diesem Album? Hm nein, lassen wir lieber. All das würde dem vierten Studioalbum von DJ Koze auch überhaupt nicht gerecht werden. Knock Knock weiß nämlich zu überzeugen. Mit spannenden Synthesizern, wohlwollenden Gitarrensoli und spektakulären Songs halten wir hier ein ganz besonderes Album aus dem ersten Halbjahr 2018 in den Händen.
Beschreiben lässt sich der Sound wohl am ehesten mit Adjektiven wie psychedelisch, mysteriös und verträumt. Übertriebene Bässe und einen richtigen „Banger“ sucht man indes vergebens. Ein gelungener Ansatz von einem Künstler, der versucht den Fokus wieder auf die Tanzfläche, weg vom eigentlichen DJ-Pult, zu richten. Die Songs bringen einen dazu, sich endlich mal wieder richtig fallen und die Stimmung des Albums voll auf sich wirken zu lassen.
Wenn man gerne in Schubladen denkt, könnte man das Album wahrscheinlich auch einfach den späten Neunzigern zuordnen. Beim Anhören des fast 80-minütigen(!) Albums lassen einen die unzähligen Filter und Effekte phasenweise sogar an Daft Punk denken. Mit „Pick Up“ findet sich ein Song auf dem Album, dessen Intro stark an „One More Time“ erinnert und im Sommer zum ständigen Begleiter werden könnte. Darüber hinaus liefern viele Gäste wie beispielsweise Sophia Kennedy oder Róisín Murphy genügend Abwechslung und begleiten mit ihren Stimmen das klangliche Abenteuer. Eingängig sind fast alle der 16 Tracks und somit ist Knock Knock eine spannende Platte, um sich vom stressigen Alltag abzulenken oder die Ferien richtig zu genießen.
Anspieltipps: Music On My Teeth & Scratch That (Spotify)