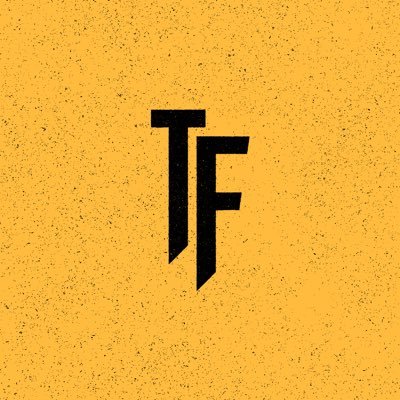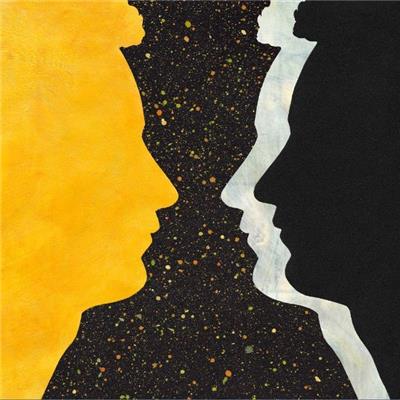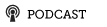Parquet Courts – Wide Awake!
„We are conductors of heat, sound and energy/ and I bet that you thought you’d had us figured out from the start“ – Mit dieser Kampfansage starten Parquet Courts in ihr fünftes und bisher bestes Album, das den Eindruck von „Stonerband“ zu (natürlich!) „woke as fuck“ verschiebt. Schon auf dem Titeltrack „Wide Awake“ bellt Sänger A. Savage die Worte „I’m wide awake! Mind so woke ’cause my brain never pushes the brakes!“ mit dermaßener Intensität heraus, dass die nachgeschobene Frage „anybody sleepy?“ als rein rhetorisch angenommen werden muss. Anderswo kombiniert das von zitierbaren Zeilen überquellende Album politische Kritik mit hervorragenden Punchlines („Savage is my name because savage is how I feel/ when the radio wakes me up with the words ‚suspected gunman‘“) und morbidem Humor, so singt z.B. ein Kinderchor den Refrain „Death Will Bring Change“.
Nebst lyrischer Hochform zeigt sich auch eine erfreuliche Weiterentwicklung in der Musik, die von geradlinigem Rock in eine Mischung aus Punkbeats und Grooverhythmen gemorpht ist, bestens hörbar in „Tenderness“. Angetreten waren die Courts mit dem Ziel, „eine Punkplatte aufzunehmen, die man auch auf einer Party spielen kann“. Wenn deine Party das wütende Ankreiden von Ungerechtigkeit und die klandestine Planung von Systemumstürzen beinhaltet, go for it! Wenn nicht, hörs dir halt allein an. Es lohnt sich!
Anspieltipps: „Freebird II“ & „Total Football“
Free Cake for Every Creature – The Bluest Star
Katie Bennetts omnibenevolentes Songwriting-Projekt Free Cake for Every Creature spielt auf The Bluest Star (aber auch im Allgemeinen) Musik, die zumeist so simpel und lo-fi ist, dass jeder sie jederzeit nachspielen könnte (vorausgesetzt, man beherrscht die Gitarrenbasics oder ein paar Synthieakkorde). Gelegentlich rumpelt noch ein Schlagzeug über Bennetts Stimme, die sich so sanft anfühlt wie der Kopf deiner Liebe auf deinem Bauch an einem Sonntag voller Watte im Kopf. Diese zelebrierte Schlichtheit wird in den Lyrics fortgesetzt, was deren Schönheit sogar noch mehr Gewicht verleiht. Zeilen wie “Walked for hours aimlessly/ Washed in the nothing, happily/ The world went on without me/ And I let it, happily” suggerieren, dass es sogar glücklich machen kann, dass man der Welt egal ist, und das ist eine wirklich sehr befreiende Erkenntnis. Danke Katie Bennett!
Die verschrobene Lebensfreude gepaart mit Momenten der Nostalgie und Melancholie verleihen The Bluest Star für mich in etwa die Stimmung von alleine Dreiertandem fahren, und wenn das kein großartiges Gefühl ist, dann weiß ich auch nicht.
Anspieltipps: „Riding Into the Sunset in a Busted Car“ & „Shake It Out“
Let’s Eat Grandma – I’m All Ears
Leider erinnert mich der Name Let’s Eat Grandma immer noch in allererster Linie an den Plüschwolf von IKEA, aus dessen Bauch man per Klettverschluss eine sichtlich verstörte Oma herausoperieren kann. Ob sie da drin LEGs sehr weirdes Debütalbum I, Gemini mit seinen übereinandergelegten Fistelstimmen und Blockflötenklängen gehört hat, bleibt unbekannt. Zwei Jahre später sind die beiden Musikerinnen Rose und Jenny aus Norwich in England jedenfalls zurück und smashen in ihrer ersten Single „Hot Pink“ mit der Hilfe von SOPHIE erst einmal das Patriarchat und dann alles, was sonst so schief läuft im Umgang der Gesellschaft mit jungen, starken Frauen. Fantastische Beats gepaart mit kräftigen Synths setzen den Kurs ihrer neuen Platte fort und passieren dabei ein Saxophonsolo („Falling Into Me“), eine wunderbare Liebesballade („I Will Be Waiting“) und holen zum finalen Rundumschlag im elfminütigen Epos „Donnie Darko“ aus, dessen langantizipierter Stretta wirklich der Beeindruckendste ist, den ich dieses Jahr gehört habe. Ein würdiger Zweitling und ein großer Sprung nach vorne für Let’s Eat Grandma, die mir mit I’m All Ears 2018 sehr versüßt haben.
Anspieltipps: „Donnie Darko“ & „Ava“
Daughters – You Won’t Get What You Want
Mit You Wont Get What You Want haben Daughters diesen Oktober mit Leichtigkeit mein Lieblingsalbum dieses und vermutlich auch des letzten Jahres rausgebracht. Das Wort „Leichtigkeit“ wirkt hier allerdings etwas deplatziert, denn mit YWGWYW schlägt eine Schwere, Düsterheit und Aggressivität aus den Lautsprechern, die einen mit Sicherheit sehr tief hinabreißen wird. Nein, hier wartet ein knapp 50 minütiger Trip durch die dunkelsten Seelenabgründe auf einen. Alexis Marshalls Vocals, mal verstörend manisch, mal mantraartig beschwörend, sind derartig apathisch, fast unmenschlich, dass sie sich, ironischerweise, ‘organisch’ mit den wahnsinnigen Instrumentals verbinden. Wahnsinnig hier im wahrsten Sinne gemeint, denn dieses Album drückt einen sehr gekonnt aus jedweder gesunden Alltagsharmonie. Remineszenzen an die Post-Pioniere Slint dürften dem geneigten Hörer ebenfalls auffallen in dem fast orchestralen “Ocean Song”.
Auf ihrem letzten Album Daughters aus dem Jahre 2010 hatten die Rhode Islander schon ihren innovativen, aus experimentellen Noise und Post-Hardcore Elementen bestehenden Trademarksound gefestigt, doch der Sprung zu YWGWYW wird nicht nur für mich ein unerwarteter gewesen sein: Hypnotische Indutrialpassagen gehen in Ausbrüche aggressivster Art über, wobei hie und da kurze Lichtblicke aufschimmern, z.B. beim durchaus an den Sound von den neueren Swans erinnernden Song “Satan in the Wait” oder dem Closer “Guest House”. Auch durch diese beinah ‘spirituell’ zu nennenden Momenten setzen Daughters gekonnt Akzente und erzeugen ein Hörerlebnis von einer Intensität, wie ich es bisher bei nur wenigen Alben erlebt habe.
Bei all der Dynamik und Abwechslung über die Spieldauer gehen die einzelnen Songs dennoch sehr fließend ineinander über und bilden ein geschlossenes und packendes Hörerlebnis, dass mich jetzt noch immer fasziniert wie am ersten Tag.
IDLES – Joy As An Act of Resistance.
Bereits das Release ihres Debut-Albums Brutalism im Herbst letzten Jahres versetzte Fans und Presse in einen Zustand von enthusiastischem Schock und war für Viele unter den besten Veröffentlichungen des Jahres. Punkrock galt lange Zeit als tot, aber IDLES haben ihn einfach wieder ausgegraben, reanimiert und siehe da: So lebendig wie zu seinen besten Tagen! Der Sound so aggressiv und rotzig, wie die Texte politisch scharf und pointiert.
Knapp ein Jahr später legen die Engländer mit JAAAOR nach und schaffen es sogar noch, ihr Debüt zu übetreffen. Das Songwriting ist ausgefeilter, diverser und auf Albumlänge geschlossener.
Inhaltlich geht es um Immigration, Liebe und Selbst-Liebe, Homophobie und Klassendenken. Der Sänger, Joe Talbot, beschrieb das Album so: „This album is an attempt to be vulnerable to our audience and to encourage vulnerability; a brave naked smile in this shitty new world.“
Anstelle der Faust steht bei IDLES die Umarmung, ihre Revolution ist eine Rückbesinnung auf das Gemeinsame. Rythmisch ist das Album, abgesehen von der Ballade “June” in der Albummitte durchgehend stark und elektrisierend. Beinahe jeder Track bleibt im Ohr und ist catchy wie gute Angler – ohne dass man das Gefühlt bekommt, hier würde von sich selbst geklaut werden. IDLES zeigen, wie innovativ, interessant und abwechslungsreich Punk im Jahre 2018 klingen kann. Wer die Chance hat, die Herren live zu erleben, sollte diese um jeden Preis ergreifen, denn auf der Bühne funktionieren die ohnehin schon bärenstarken Tracks sogar noch besser.
JAAAOR ist für mich eines der spannendsten Alben des Jahres und lässt einen mit Spannung darauf warten, was wohl in Zukunft von IDLES kommen wird.
Earl Sweatshirt – Some Rap Songs
Mehr als drei Jahre war es still um Earl Sweatshirt. Es war nicht einmal sicher, ob Earl überhaupt noch aktiv an Musik arbeiten würde. Um so überraschender war das Release von Some Rap Songs Ende November des Jahres.
Der Titel ist schnell als klares Understatement zu identifizieren. Der Kalifornier Rapper hat sich auf seinem dritten Full-lenght Release musikalisch stark weiterentwickelt: Die Beats, zum größten Teil selbstproduziert, sind experimenteller und jazziger geworden und enthalten Trip-Hop-Elemente. Auch glitchyartiges Sampling, wie auf der ersten Singleauskopplung „Nowhere2go“, finden sich auf dem nur 24-minütigen Album. „December 24“ erinnert dabei raptechnisch noch am ehesten an die Zeiten von Odd Future.
Inhaltlich geht es auf dem Album um Familienprobleme, Drogenmissbrauch, Depression und den Tod seines Vaters. So sind Sprachsamples von Earls Mutter sowie von seinem Anfang des Jahres verstorbenen Vater auch auf dem Track „Playing Possum“ zu hören
In den insgesamt 15 kurzen Tracks hat Earl Sweatshirt sehr erfolgreich die verschiedensten musikalischen Ideen sehr prägnant umgesetzt – hier ist nichts in die Länge gezogen. Textlich gehört er ohnehin zu den talentiertesten der Szene: Komplexe Reimschemata und eine klare Bildsprache regen alle paar Sekunden die Vorstellung des Hörers an, entwickeln Ideen und Stimmungen im Kopf, was sich so von Kopfnicker zu Kopfnicker durch das ganze Album hindurch zieht. Absoluter Loopshit!
Eines der heißesten Rap-Releases des Jahres und meine Top-3 für 2018!
The Wombats – Beautiful People Will Ruin Your Life
Zu meiner Schande muss ich gestehen, bis Anfang dieses Jahres noch nie von der 2003 gegründeten Band gehört zu haben. Trotzdem ist das im Februar 2018 erschienene Album der englischen Alternativ-Rock-Band mein Album des Jahres. Warum? Weil mich dieses Album 2018 begleitet hat. Anfang des Jahres erzählte mir eine Freundin absolut begeistert, dass sie The Wombats live gesehen hätte. Ich freute mich für sie, aber die Frage, ob ich die Gruppe kennen würde, musste ich leider verneinen. Mein Interesse war jedoch geweckt. Ich begann das neue Album, aber auch ältere Lieder, rauf und runter zu hören. Im Bus, am See, selbst in der SLUB beim Lernen leisteten mir The Wombats Gesellschaft. Die 11 Songs des Albums sind entspannte Indietracks, die durch den rockigen Charakter der Musik nie langweilig wirken. Ein roter Faden zieht sich durch Beautiful People will Ruin Your Life, sodass man es an einem heißen Tag am See komplett durchspielen lassen kann und sich trotzdem bei jedem Song denkt: Endlich kommt der Hit, auf den ich gewartet habe. Ein absolut rundes Album in das man unbedingt reinhören muss, besonders wenn man die Band noch nicht kennt.
Anspieltipps: „Lemon to a Knife Fight“ & „Turn“
The FAIM – Summer Is A Curse
Jeder kennt sie, diese Radiosender, die das im Frühjahr erschienene Album eines bekannten Künstlers noch im Winter als Neuentdeckung feiern. Diese Radiosender, die dreimal am Tag denselben Popsong spielen, bis man ihn nicht mehr hören kann. Diese Radiosender, die im Auto nebenbei dudeln, wenn man sich wie ich das Auto der Eltern geliehen hat, um schnell noch einkaufen zu fahren. Während einer dieser Autofahrten präsentierte mir ein solcher Radiosender eine Neuentdeckung, die dann tatsächlich auch eine war. Im März 2018 hatte die australische Band The FAIM ihr erstes Album veröffentlicht. Der Song „Summer Is a Curse“, der dem Album seinen Namen gab, blieb mir auch weit nach der schicksalhaften Autofahrt im Gedächtnis. Es ist ein fröhlicher Pop-Rock-Song zu dem es sich gut tanzen und mitsingen lässt. Auch die anderen 6 Lieder des Albums haben Ohrwurmpotenzial. Die Gruppe streift fast jedes Genre einmal, sodass ihre Musik mal hymnisch, mal melancholisch und mal düster klingt. Dabei bleiben sie ihrem grundlegend fröhlichem und sympathischen Popsound dennoch treu. Summer Is a Curse ist ein rundes Album, in dem der Hörer einen Einblick in das ganze Potenzial dieser jungen Band bekommt.
Anspieltipps: „Summer Is A Curse“ & „My Heart Needs to Breathe“
George Ezra – Staying at Tamara’s
Spätestens nach seinem Hit „Budapest“ aus dem Jahr 2013 dürfte George Ezra auch Nicht-Musikkennern ein Begriff sein. Im Frühjahr 2018 erschien sein neues Album Staying at Tamara´s. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Album zum ersten Mal in voller Länge auf einer Fahrt von Kroatien nach München gehört habe, das es für mich wie die Geschichte eines Roadtrips klingt. Mit seiner unverwechselbaren tiefen und vielseitigen Stimme zeigt der Sänger unterschiedlichste Facetten des Country-Rocks auf. Anfangs klingen die Lieder fröhlich und man bekommt das Gefühl, George Ezras Freude zu spüren, dass es endlich losgeht; mit dem Roadtrip und dem neuen Album. Songs wie „Get Away“ vermitteln dabei das Gefühl von Freiheit und Neugier auf das Ungewisse. Zum Ende geht es dann melancholischer zu. „The Beautiful Dream“ bringt schließlich den Abschluss des Albums. George Ezra behandelt Themen wie Liebe und Flucht aus dem Alltag mit einer Leichtigkeit, dass man jedes Lied mitsingen möchte. Am besten im Cabrio auf dem Weg ins Nirgendwo.
Anspieltipps: „Pretty Shining People“ & „Only a Human“
Parcels – Parcels
Aus dem immer sonnigen Australien ins grau-nasse Berlin ziehen? Was wie eine ziemliche Schnapsidee klingt, haben die Jungs von Parcels vor drei Jahren wirklich durchgezogen. Was dann folgt, klingt wie im Film: Nachdem sie sich zu fünft monatelang ein Doppelbett-Apartment teilen und auf unzähligen Festivals in Europa spielen, wird die französische Band Daft Punk auf die Musiker aufmerksam. Diese produziert mit ihnen die Single „Overnight“ und so langsam zeichnet sich ab, was für Potential in den Australiern schlummert.
Viel davon steckt auch in ihrem nun endlich erschienenen Debütalbum Parcels, welches die Band komplett selbstproduziert hat. Und das war auch genau richtig so, denn ihren eigenen Sound haben sie schon längst gefunden. Beschreiben lässt sich dieser wohl nur als sommerlich, leicht melancholischer Mix aus New Wave, Elektro-Pop und 70er Disco-Funk. Catchy, zeitlos und vor allem tanzbar sind die ruhigen und schnellen Lieder der Platte. Die Jungs haben ein Gespür für dynamische Arrangements und wissen mit eingängigen, tighten Beats zu verzücken.
Synthies, Bass, Gitarren und Drums harmonieren auch live genial miteinander und das macht diese Band vor allem für die anstehende Festivalsaison zum Geheimtipp!
Anspieltipp: „Everyroad“
Tom Misch – Geography
Wenn du ein Wohlfühlalbum suchst, in dem die Sonne durch die Baumkrone auf die grünglänzende Parkwiese scheint und die umherschwirrenden Bienen sich auf den blühenden Blumen tummeln, bist du bei Tom Mischs Album Geography genau richtig. Der Engländer mit der warmen, gefühlvoll summenden Stimme hat die Picknickdecke mitgebracht und packt aus seinem Bastkorb allerlei süße Leckereien aus. Plätschernde E-Gitarrensounds, rhythmisch sprudelnde Baselines und behutsame Schlagzeugbeats sind das Erfolgsrezept des 23-jährigen, der mit seinem Debütalbum zeigt, warum er mit zu den spannendsten Uprising-Talenten von der Insel gehört.
Mit seiner Mischung aus Soul, Hip-Hop und Jazz schafft Misch nichts spektakulär Neues, aber halt etwas so Schönes wie einen sorgenfreien Sommernachmittag im Park, an dem die Zeit einfach mal stillsteht.
Anspieltipp: „Movie“
Donny Benet – The Don
Donny Benet sieht aus wie sich seine Musik anhört. Dicker Schnauzer, Halbglatze und das restliche Haupthaar pomadig nachhinten gegelt. Der Sound: Pure 80er-Disco! Mit diesem Look, kombiniert mit pinkem Anzug und hervorquellender Brustbehaarung, bleibt einem auch nicht viel anderes übrig. Doch der Auserwählte macht das Beste aus seinem Schicksal und schenkt uns einen groovigen Gefühlscocktail.
The Don ist Album Nummer Vier des menschgewordenen Synthesizers und auch dieses lockt jeden Tanzmuffel hinterm Ofen hervor. Mit treibender Drum-Maschine, blubberndem Bass und seiner unbeherrschbar lustvollen Stimme entführt Benet den Hörer in eine vergangene Epoche direkt auf die pulsierende Tanzfläche. Der italienische Barde aus Australien verbindet meisterhaft zwei Zeiten miteinander. Zum einen das Heulen der Synthesizer, welche den aufgedrehten 80ern nostalgisch hinterher zu trauern scheinen. Zum anderen seine gegenwartsbezogenen Texte, in welchen er Online-Liebe oder Fitnesswahn besingt.
Ob Kitsch oder Kunst: Donny Benet sorgt mit seiner elektronischen Tanzmusik für Blasen an den Fußsohlen und lässt uns gefühlvoll durch die Nacht grooven.
Anspieltipp: „Konichiwa“
Yves Tumor – Safe In The Hands of Love
Wie spannend Pop im vermeintlich postinnovativen Zeitalter noch sein kann, zeigt zum nunmehr vierten Mal Yves Tumor auf. Waren allerdings gerade Serpent Music und Experiencing the Deposit of Faith noch klar auf Differenz bedacht, wird die Experimentierwut auf Safe In The Hands of Love merklich umpuffert und die verblüffte Hörerschaft Zeugin von einem unerwartet inbrünstig herausposaunten Tumorschen Pop-Gelübde; und wie es sich gehört, wird das vielleicht eklektischste und imposanteste Popspektakel anno 2018 feierlich durch eine kurze, aber sehr prägnante Fanfaren-Ouvertüre eingeleitet, bevor mit Croatian Amor aka Loke Rahbek der erste Kollaborationspartner zum Tanz gebeten wird, Tumor sich also – wie auch im späteren, intensiven Dronemoloch “Hope in Suffering” mit Puce Mary – bei der dänischen Klangoffensive aus dem Posh-Isolation-Umfeld bedient. Allerdings wird auch hier bezeichnenderweise schnell klar, dass das Pop-Credo auf Safe In The Hands of Love fast durchgehend leitendes Motiv bleibt und aufkeimende deviante Impulse in eine Sicherheitszone einhegt, so dass “Economy of Freedom” sich nach zweiminütigem Ringen zur Hälfte in warmen und bekömmlichen Ambient-Pop verwandelt statt dem Drang, ins Noisige zu kippen, nachzugeben. Auf der anderen Seite stehen offene Bekenntnisse an konzessive Töne, wie sie die beiden Hits “Honesty”, das in ein avanciertes Spiel mit gesättigten 90s-Dance-Beats und Boygroup-Sounds tritt sowie “Noid”, das Spuren von Brit Pop sowie den Big-Beat-Furor der frühen Björk in sich aufnimmt und nicht nur wegen seines Gesangsparts wie zu Ende gedachte Bloc Party (zur Intimacy-Ära) klingt, ausstellen. Yves Tumor verlässt mit seinem neuesten Wurf also endgültig die Nische, gesellt sich zur Pop-after-Pop-Riege um KünstlerInnen wie Dean Blunt, Laurel Halo, Sophie oder Arca und präsentiert die Extreme Avantgardismus und Populismus ästhetisch gekonnt versöhnenden Transzendenzpop, der so nah am Puls der Zeit pocht wie es nur geht und gleichzeitig unmissverständlich den Anspruch verkündet, in die Zukunft zu weisen.
Anspieltipps: „Honesty“ & „All the Love We Have Now“
Brett Naucke – The Mansion
Wenn das Persönliche und Innerliche in der Popkultur als ultimative Marker des Authentischen fungieren, so ist am Ende auch hier doch immer eine gewisse Vereinheitlich- und Referenzialisierbarkeit unabdingbar, um die gewünschte emotionale Anschlussfähigkeit und Übertragungsleistung herzustellen. Musik wie The Mansion von Brett Naucke gleicht daher trotz ihres offenen Bezugs zum Authentizitätszeichen umso mehr einer Einschließung, als sie mit einer Rückschau auf die eigene Kindheit die rein subjektive Erinnerungswelt Nauckes selbst als eine Art unteilbare Letzteinheit zu ihrem Gegenstand erhebt und sich dabei gegen allzu einfache Ausbeutungsmuster der oftmals ersehnsüchtelten Einheit von Werk und Autor verwehrt.
Zum einen geschieht das, weil die Stücke auf Lyrics verzichten, zum anderen aber vor allem, weil sich auch die Klangarchitektur einer kohärenten Dramaturgie sowie offensichtlichen Verknüpfungspunkten entzieht und stattdessen so ungreifbar und unstet bleibt wie von verzerrten Rekonstruktionsmechanismen angegriffenes und abgefälschtes Erinnerungssubstrat. Schon der Opener “The Vanishing” mit seinen inmitten von New-Age-Flächen aufplatzenden Noiseblasen macht stellvertretend klar, dass das Erinnerte in The Mansion sich nicht zum Abstraktum verdichten lässt und Triggerbedienung nicht auf dem Programmplan steht. Der geneigten Hörerschaft bleibt der Zutritt zu Nauckes hermetischem Kosmus also zwangsläufig ein wenig versperrt, wenn sie eine unbrüchige Erzählstruktur will, nichtsdestotrotz darf sie sich aber über ein spannendes kleines Sounduniversum mit aufgesprengter Eigenlogik freuen.
Anspieltipps: „A Mirror In The Mansion“ & „No Ceiling In The Mansion“
Topdown Dialectic – Topdown Dialectic
Acht kleine Dancefloor-Exegesen liefert/n Topdown Dialectic mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum ab. Wer genau sich hinter dem Moniker verbirgt, weiß man nicht genau, einzig bekannt ist die Zuordenbarkeit zum Kassettenvertrieb Aught. Dieses unnahbar-unpersönliche Motiv der Informations- und Selbstauskunftsverweigerung und mystischen Verschleierung der Person hinter der persona wird durch die kokette Betonung des Formellen und Kalkulierten (Titelnamen hier: A1-A4; B1-B4) sowie die analytische Strenge, mit der die Tracks daherkommen, noch verstärkt. Denn Topdown Dialectic lädt nicht zu Ekstase und Selbstverschleißung ein, sondern untermalt einen Tanz auf Distanz, der sich konsequent vom Kopf herleitet. Das kontemplative Element der Namensgebung findet sich also auch im Sound selbst wieder: Die Musik ist nicht getrieben und körperlich, sondern abstrakt und der Ideenwelt entstammend, das Bewusstsein bestimmt das Sein. Wenngleich die einzelnen Tracks also wie autonome Soundschleifen mit individuellem Puls, mikroskopischem Fokus und eigenem Narrativ wirken, passt sich das Material doch einem übergeordneten Konzept (jeder Song dauert exakt 5 Minuten) an und kommt der Beat eher zu sich selbst als sich an ein kollektives Konkretum oder Handwerklichkeit zu binden. Topdown Dialectic besteht aus maschinellen Operationen, die in algorithmisch kodierter Anmut blubbern, scharren, klopfen und glucksen, als eine Art idealistischer Hypnagogic Techno oder Unterwasser-Rave (wie in Höhepunkt “B3” mit seinem ausgewaschenen Lutto-Lento-Groove) daherkommen und in ihrer Gesamtheit zu den unfassbarsten und interessantesten Versuchsanordnungen im weiten Spannungsfeld gegenwärtiger elektronischer Musik zählen.
Anspieltipp: „B3“
Tiny Moving Parts – Swell
Frickeliges Gitarrentapping, zumeist traurige, aber durchwegs optimistische Texte und ein energiegeladener, intensiver und dennoch melodiegetragener Gesamtsound: Mit Swell erklimmen die aufstrebenden Emo-Math-Rocker Tiny Moving Parts den Thron zum Album des Jahres.
Das sympathische Trio aus Minnesota um Dylan Mattheisen schafft es mit seinen beiden Cousins erneut Emo, Pop-Punk, Math-Rock und Post-Hardcore so zusammenzupacken, dass am Ende für jeden Genre-Anhänger die richtige Mischung dabei herauskommt. Was bei Erstkontakt vielleicht hektisch und vertrackt wirken mag, wurde auf Swell nur noch weiter perfektioniert. Als einfache Emo-Pop-Punk Band sollten Tiny Moving Parts keinesfalls abgestempelt werden. Viel zu kurzweilig, zu ausgefeilt, aber dennoch mitreißend und berührend sind ihre Songs, zu anspruchsvoll das Songwriting.
Von vorn bis hinten zeigt das Album kaum Schwächen, obwohl es galt, an das bisherige Überwerk Celebrate von 2016 anzuknüpfen. Nach nur wenigen Durchläufen bleibt jeder Song im Ohr hängen und schon bald möchte man Songzeilen an Wände pinseln oder selbst mitschreien. Ein Album über Emotionen, das dennoch reichlich Optimismus in sich trägt und den Spaß und die Spielfreude der Band erkennen lässt.
„May your brain cells swell with love!”
Anspieltipps: „Applause“ & „Whale Watching“
Jaguwar– Ringthing
Mit Ringthing lieferten Jaguwar direkt schon zu Beginn des Jahres einen heißen Anwärter auf den Titel des Albums des Jahres und ein wärmstens zu empfehlendes Debütalbum. Das Shoegaze-Trio, das zunächst in Dresden ansässig war, hat es mittlerweile nach Berlin verschlagen.
Vor alten Helden wie My Bloody Valentine, Ride oder Slowdive brauchen sich Jaguwar beileibe nicht verstecken. Die Nähe zu The Cure ist dank der Stimme von Gitarrist und Sänger Lemmy ebenfalls nicht zu überhören. Auf Ringthing steuert die Band durch Shoegaze, Noise, Pop und Post-Rock. Sie selbst bezeichnen ihren Stil als „Krach und Detail“. Ihre Spur zwischen einer gelungenen Mischung aus treibenden und ruhigen Albumabschnitten finden sie durch hängenbleibende hallende Melodien. Verbunden mit melancholischen Lyrics, wird von Song zu Song das ein oder andere Wendemanöver unternommen, welche sich dann zu großartig aufgeschichteten Höhepunkten weiterentwickeln.
Nach und nach entpuppt sich Ringthing zu einem mehr als abwechslungsreichen Genremix. Konzentrieren sich auf der A-Seite, u.a. mit der Single “Crystal”, vor allem die Stücke, die direkt im Ohr hängen bleiben, wird auf dem eigentlichen Highlight, der B-Seite, zumindest ein Gang heruntergeschaltet, die Lyrics rücken in den Vordergrund und die Stücke bauen sich erst nach und nach zu ihren Höhepunkten auf.
Mit dem Debütalbum im Gepäck ließ sich die Band im Februar damit auch schon in Dresden blicken. Ein berauschender, energiegeladener Auftritt umrahmt von meterhohen Soundwänden, die in der Melancholie des Momentes aufeinander krachten. Das Ostpol dürfte an diesem Abend noch lange nachgeklungen haben.
Anspieltipps: „Skeleton Feet“ & „Week“
New Native – Asleep
New Native ist ein Quartett aus Wien, das bereits mit diversen EPs auf sich aufmerksam machen konnte. Im Vergleich dazu wurde ihr im Februar erschienenes Debütalbum Asleep nun wieder eine Nummer ruhiger und bedächtiger.
Verträumter melancholischer Indie-Dream-Pop mit einem guten Einschlag zum Emo der 90er und einer Prise Post-Rock: Turnover oder Death Cab For a Cutie würde die Platte sicher auch gefallen. Große Gitarrenausbrüche sind auf der Platte nur selten und nur an ausgewählten Stellen platziert worden. Die zumeist sehr nachdenklich gestimmten, in sich gekehrten Texte stehen im Vordergrund und werden durch mal kraftvolle, meist aber dezente Instrumentalisierung begleitet.
Die durchweg treibenden und stärksten Stücke des Albums befinden sich auf der ersten Hälfte der Platte. Allen voran „The Worst of All“, aber auch der Album-Opener „Awful Thinker“ oder das voranschreitende und am Ende ausbrechende „Night Scene“. Die zweite Hälfte überzeugt vor allem mit „Tied Down“, dem Highlight der Platte und mit dessen treibenden Snare-Beat zur euphorischen Grundstimmung des Stückes. Gegen Ende hin verliert sich die Platte etwas in zu viel Träumerei, New Native beweisen aber allemal, dass auch die deutsche 90s-Emo-Szene Potential hat.
Anspieltipps: „Tied Down“ & „The Worst of All“