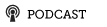Der Menschenschwarm, der einen, aus der Straßenbahn ausgespuckt, die lange Auffahrt Richtung Haupteingang des Festspielhauses Hellerau zieht, führt etwa auf halber Strecke an einer immens großen Feuerschale vorbei. Die darum Versammelten wirken von weitem als würden sie versuchen Hades aus der Unterwelt heraufzubeschwören um das Festspielhaus zu weihen. Aber auch wenn man bei näherem Heranschreiten dann doch langsam erkennt, dass die Menschen eigentlich recht gewöhnlich aussehen und sich einfach nur aufwärmen wollen, wird eine gewisse Grundstimmung den musikalischen Abend begleiten.

Foto: Jasper Bendix
Fürs erste scheint Hellerau allerdings davon noch verschont geblieben. „Alice Roger“, eine durch und durch Dresdner Band, die – so steht es auf der Webseite geschrieben – authentischen, deutschsprachigen Rock-Pop spielen, betreten um 20 Uhr den Nancy-Spero-Saal und versuchen das Festival mit ihrer Ehrlichkeit und ihrem Gerade-heraus-Spirit zu beleben. So wirklich gelingen will das nicht; zu sehr erinnert das alles an die „Invasion der Killerpilze“ 2006, die spätestens nach dem Untergang von VIVA und MTV keinen mehr so wirklich interessierte. Parallel zwei Türen weiter aber soll ein gewisser „Jonethen Fuchs“ samt Anhang die Gemüter in träumerische Landschaften entführen. Aber auch hier gehen Anspruch und Wirklichkeit leider wieder weit auseinander, zumindest, wenn die Bosshoss-Werbung auf Prosieben schon zu Jugendzeiten auf stumm geschaltet wurde. Für das eher jüngere Publikum waren die Neo-Country-Melodien dann doch ein klein wenig zu alt, obgleich hie und da einige unvorhergesehene Instrumentalpassagen sich sehen lassen konnten.

Alice Roger | Foto: Jasper Bendix
Als Jonethen Fuchs den Weg für „Andi Valandi & Band“ frei macht, gibt es ein kleines Aufatmen. Dieser Band mit ihrer Gallionsfigur Andi Valandi, der sich barfuß und in Blumenleggings anscheinend am wohlsten fühlt, geht es so gar nicht darum, ernste Gefühle zu transportieren oder großen Eindruck zu hinterlassen und sie bespielen den Dalcroze-Saal wie ein besetztes Wohnzimmer. In Songs wie „Linksversifft“ oder „Snapchat“ werden triviale Alltagssituationen und Spät-68er-Ethos auf selbstironische Art zusammengebracht. Andi Valandi (der mit seiner rauhen Stimme jede Kneipe berauschen könnte) und seiner so ungleichen Band geht es glücklicherweise weder darum Mitleid zu erzeugen, noch ihre Hörer irgendwie zu belehren. Die Rio-Reiser-Punk-Attitüde funktioniert auch 50 Jahre später noch.

Andi Valandi und Band | Foto: Jakob Müller
Allerdings hält diese angenehme Entlastung nur kurz an. „Cedric“, die zuerst die große Hauptbühne besteigen, stehen ganz zu ihrem Pathos: Gefühlsüberladener, mit zusammengekniffenem Gesicht vorgetragener Gesang, lange, ausgedehnte, apokalyptische Gitarrenpassagen, doch dann auch immer wieder raue, kantige Riffs. Man täte der Band vermutlich nicht unrecht, drücke man ihr den „Post-Metal-Stempel“ auf. Musikalisch definitiv das bis dahin stärkste, auch wenn der drückende Pathos einem dann doch irgendwann zu viel wird. In erster Reihe unentwegt am Headbangen: Oyèmi Hessou, die den Abend in der Folge noch mit zwei Bands um einiges bereichern soll.

Cedric | Foto: Jasper Bendix
Doch während man ein ums andere Mal durch die Hallen irrt und sich wundert, wo denn nun die versprochenen Affen abbleiben, trifft man auf eine Straßenband, wie sie im Buche steht, die ein angenehm-verspieltes Zwischenprogramm bieten. Nach der Realisierung ist es zwar zunächst eine kleine Enttäuschung, dennoch muss man feststellen, dass dieser Polka-Trupp die wahren Gewinner des Abends sind, da sie gleich viermal aus dem Käfig und auf die Besucher*innen gehetzt werden.
Doch zurück auf der Hauptbühne ist es eben erwähnte Oyèmi Hessou, die sich eine halbe Stunde zuvor noch fleißig in den Zuschauerreihen schüttelte, und nun mit ihrer Band „Jaguwar“ den zentralen Saal bespielt. Die drei-köpfige Band, die beim namenhaften Tapete Records unter Vertrag steht, macht verspielten Shoegaze mit verträumten, ohrwürmigen Melodien in der Tradition 90er-Jahre Bands wie Lush, Ride oder My bloody Valentine. Der definitive Höhepunkt dieses Abends, das darf an dieser Stelle schon verraten werden, auch da die Lead-Sängerin und Bassistin eine unheimliche Energie entfaltet und in ihrem souveränen Spiel stets in engem Kontakt zu den Zuschauer*innen steht. Dresden, so verkündet sie zwischendurch, sei immer ein ganz besonderer Ort zum Spielen, auch wenn ihre neue Wahlheimat mittlerweile eine andere (Berlin) ist.

Jaguwar | Foto: Jakob Müller
Ein letztes nennenswertes Konzert gaben neben „Grimény“, deren Math-Rock zwar zuhause erstmal sehr interessant klang, live dann aber doch als schwer zugänglich gesehen werden muss, die Neustädter-Kultband „Paisley“. Brit-Pop aus der Gallagher-Manufaktur, der sich live aber dennoch sehr gut macht, wenn man dazu aufgelegt ist. Nachdem die Band zuletzt etwas in ihrem Sound stagniert war, kündigten sie mit diesem Auftritt einige neue Songs an. Und siehe da: ein, zwei Synthesizer und plötzlich passt der Oasis-Vergleich so gar nicht mehr. Stattdessen: Ein Hauch Metronomy.

Space Raptor | Foto: Jasper Bendix
Abseits all der Konzerte bot das Bandstand dem interessierten Besucher aber auch Möglichkeit zu einer Vielzahl weiterer Aktivitäten. An beiden Festivaltagen konnten beispielsweise Kamera-Affine einen Konzertphotographie-Workshop am Nachmittag besuchen, den man abends dann auch
praktisch anwenden konnte. „musikismyradar“ hingegen ist ein interaktives DJ-Set, das zwar vorgegebene Songs liefert, diese aber erst mithilfe des Publikums durch drehen, hebeln, drücken und dergleichen zum Leben erweckt werden. Ein ähnliches Motiv steckt auch hinter der Installation „kinetic objects“, ebenfalls aus Dresden, das eigentlich tote Gegenstände zum Leben erweckt und unweigerlich an Kindheits(alp-)träume erinnern lässt.
Die Aussage von Jaguwar-Sängerin Oyèmi Hessou, die vermutlich gewiss ihre Heimatverbundenheit ausdrücken sollte (und vielleicht auch ein wenig zu rechtfertigen versuchte), hat ungewollt einen wunden Punkt der ehemals anstrebenden Kultur-Hauptstadt getroffen. Zwar scheint die Stadt durchaus in der Lage, fähige Musiker*innen hervorzubringen, doch langfristig, sobald sich Erfolg anbahnt (oder anbahnen soll) nicht halten zu können. Zu verlockend sind Berlin oder Leipzig. Gerade letzteres hat Dresden umlängst mit unzähligen neuen aus dem Boden sprießenden Festivals und namenhaften Konzert-Bookings überholt. Es ist wohl kein Geheimnis mehr, dass gerade in den letzten paar Jahren die Wahl für Spielorte zwischen den beiden Städten zumeist zugunsten von Leipzig ausfällt. Der derzeit noch in Dresden residierende Musiker „Shelter Boy“ hat in einem jüngst erschienenen Interview auch bereits angekündigt, Dresden in nicht allzu ferner Zukunft für Leipzig den Rücken kehren zu wollen. Begründung: Offenheit, Experimentierfreude usw.usf..
Das Bandstand, das neben dem „Sound of Bronkow“ und dem psychedelisch-orientierten „Reverbation-Festival“ wohl eines der einzigen Musikfestivals für Bands in Dresden darstellt, wird in jedem Falle benötigt, um Dresden als Spielort (gerade in so einem schönen) attraktiv zu machen. Auch die Kooperationen so verschiedener Spielstätten wie der Groovestation und dem Jazzclub Tonne deuten darauf hin, dass Zukunft nur gemeinsam gestaltet werden kann. Und Veranstaltungen dieser Art dürften dem nicht gerade schlecht tun. Denn wenn dieser Freitagabend aus dem Bandstand eines bewiesen hat, dann vielleicht, dass es defintiv nicht an der Nachfrage mangelt.