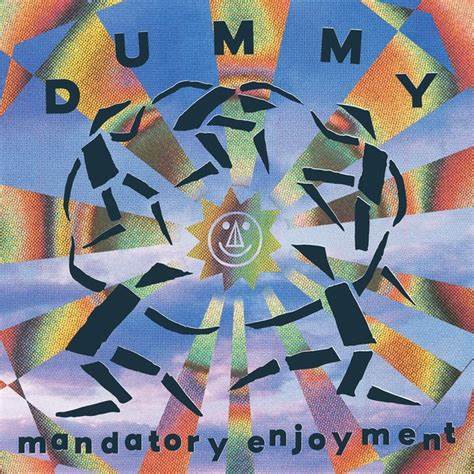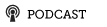Black Marble – Fast Idol
Was für ein Fund! Beim Durchforsten diverser Playlisten hatte ich ihn gefunden, und das ganz zufällig. Chris Stewart, oder besser bekannt als Black Marble präsentiert diese Jahr sein viertes Album „Fast Idol“ und katapultiert sich damit direkt in meinen Synth-Pop Himmel. Black Marble bestand anfangs aus dem Duo Stewart und Ty Kube, welches sich 2011 in Brooklyn, New York gründete, sich aber nach den ersten beide Alben „A Different Arrangement“ und „It’s Immaterial“ wieder trennten. Seitdem hat Stewart den Synthesizer selbst in die Hand genommen und schlägt auch musikalisch andere Töne an. Während die ersten beiden Alben einen dunklere Post-Punk / Cold-Wave Charme versprühten, findet man im neusten Album im gewohnten Synth-Pop-Gewand sogar Einflüsse aus Reggea und Walzer wieder. „Fast Idol“ wirkt fragmentarisch und bedient sich in seinen Texten Alltagssituationen. Dazu sagt Stewart: “People don’t expect me to be responsible for altering their outlook or mood, they come to hear something that meets them where they are. I trusted on this record that if I stayed in that space and created things from that more mysterious place, it would connect with others.” Das erste Lied der Platte, Somewhere, beginnt mit einem langsam Gemisch aus Synthesizer- & Glockenklang, bricht auf, wird schneller und das Tanzbein beginnt sich unentwegt zu schwingen. „Fast Idol“ wirkt verträumt, melancholisch und doch nach vorne gerichtet. “I want my music to stick with you after I leave, even though you might not feel like you’re any closer to knowing it.” Und damit hat er vollkommen recht.
Und wer an dieser Stelle Blut geleckt hat, der sollte sich nicht nur alle bisherigen Alben zu Gemüte führen, sondern sich auch den 21. April fett im Kalender markieren. Black Marble kommt nach Leipzig ins UT Connewitz. Meine Vorfreude ist riesig!
Anspieltipps: Somewhere & Preoccupation
Richard Walther – Over The Night
Oha, eine EP. Ob das die Chefinstanz des Campusradios zulässt? Eigentlich heißt es ja „Alben des Jahres“ und nicht „EP des Jahres“, aber „who cares / you could be my lover / for now / just for one day“ würde Richard Walther singen. Mit einer Sexpuppe unterm Arm, einem malerischen Sonnenuntergang auf dem Feld und viel Liebe im Herzen strahlt Richard Walther in seinem Video zu You Could Be My Lover das perfekte Sommergefühl aus. In seiner ersten EP „Over The Night“ vereint er lässigen Synth-Pop mit Indie-Gitarrensounds und kreiert dabei einen Sound, der an Black Marble, The Drums oder KennyHoopla erinnert, dabei jedoch eine ganz eigene musikalische Wellenlänge erzeugt. Zuvor war er in der Hip-Hop / Rapszene verankert und brachte dort Musik unter dem Namen RW raus. Doch jetzt bestreitet er neue Wege, die vor allem vom Künstler Day Wave angestoßen wurden, welcher im ersten Lockdown regelmäßig Livestreams von seinem musikalischen Schaffensprozess machte und damit einen Nerv bei Richard Walther trafen. In klassischer DIY Manier singt und produziert Walther alles selbst. Seine, mit sechs Liedern ausgestattetet, EP wirkt altbekannt und bringt gleichzeitig eine erfrischende Note in das Synth-Pop-Genre. Also, unbedingt anhören und dranbleiben, da kommt noch was!
Anspieltipps: You Could Be My Lover & Funeral Of The Computer
Requin Chagrin – Bye Bye Baby
Das Mondlicht spiegelt sich auf dem dunklen Meer wider. Hohe Wellen umschließen eine blondhaarige Frau im schwarzen Anzug. Im tiefen Blau leuchtet ihr verzerrtes Gesicht und scheint eins mit dem Wasser zu werden. Zwischen melodischen Synthesizern und sanften Indie-Gitarrensound singt die französische Künstlerin Marion Brunetto, oder besser bekannt als Requin Chagrin, über die Flucht ins Gestern. Immerwährend lastet die Nostalgie auf ihren Schultern, die sich wie ein roter Faden durch die Musik der Sängerin zieht. Zuletzt auch in ihrem dritten Studioalbum Bye Bye Baby. Verträumt und unaufgeregt streift Brunetto durch die Seiten ihres lyrischen Tagebuchs und verliert sich dabei im Strudel der Vergangenheit. So singt sie im Lied Juno : « Ça me colle à la peau / La mélodie / De nos rêves idéaux / Pour toute la vie / Ça me colle à la peau / Et tant pis / Je connais le numéro / La nostalgie… » (« Sie hängt mir nach / Die Melodie / Unserer verklärten Träume / Das ganze Leben / Hängt sie mir nach / Und viel schlimmer noch / Ich kenne die Zahl / Die Nostalgie… ») und spricht damit wahrscheinlich vielen Menschen direkt aus der Seele.
Aufgewachsen in einem kleinen französischen Dorf an der Küste wagte die Künstlerin vor ein paar Jahren den Schritt in die Großstadt. Ein Umbruch und Lebenswechsel, der im Kontrast zum bisherigen provinziellen Leben vor allem im Vorgängeralbum Sémaphore verarbeitet wurde und bis heute nachwirkt. Das zentrale Element des Wasser verweist immer wieder auf ihre Heimat und wird auch in Bye Bye Baby fortgesetzt. Doch zwischen Nachtschwärmerei und Mondgeflüster blitzt der Aufbruch ins Unbekannte. Ein Blick Richtung Zukunft.
Purple Disco Machine – Exotica
Obwohl ich erst drei Jahre in Dresden wohne, macht es mich stolz, wenn Künstler·innen aus der schönsten Stadt südlich von Hamburg auch über die Stadtgrenzen hinaus auf sich aufmerksam machen. Während die Neustädter Hip-Hop-Gruppe 01099 zumindest in der Bundesrepublik von den Kids gefeiert wird, erreicht ein anderer Dresdner seit zwei Jahren auch über den großen Teich hinaus Aufmerksamkeit. Dabei könnte dieser auf den ersten Blick ein ganz normaler Nachbar im Mehrparteienhaus sein, mit dem man ab und zu beim Müllrausbringen im Treppenhaus ein paar Worte wechselt. Der aus der DDR-stammende DJ und Musikproduzent Tino Piontek lebt in Dresden, ist Anfang vierzig, bringt seine Kinder morgens in den Kindergarten und die Schule und produziert dann bis zum Mittagessen heiße Discobeats in seinem Dresdener Studio, die um den Globus gehen. Sein Welterfolg „Hypnotized“ erreichte Platin und verzeichnet derzeit über 200 Millionen Streams auf Spotify. Gekonnt mischt er Disco mit Pop und hat mit seinem Stil auch schon Remixes für Dua Lipa, Lady Gaga oder Mark Ronson produziert. Sein Mix aus stampfenden Basedrums, funky Gitarren, nassklatschenden Snares, treibendem Bass und akzentuierten Bongos ist nostalgisch und frisch. In den Monaten meiner Bachelorarbeit, verwirrenden Zukunftsfragen und Corona-Hin-und-Her bescherte mir Tino mit seiner Musik Ablenkung und gute Stimmung. Eins meiner Jahres-Highlights war somit auch sein Live-Konzert auf dem diesjährigen Stadtfest, auf welchem ich die vielleicht schönsten zwei Stunden des Jahres erlebte. Danke, Purple Disco Machine!
Silk Sonic – An Evening with Silk Sonic
DAS Kollaboalbum des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Okay, große Worte. Aber groß sind diese beiden Herren auch schon vor diesem Album gewesen. Ein Album, auf welches ich mich ein ganzes Jahr lang gefreut habe. Anderson .Paak und Bruno Mars liefern hier in 70er-Schlaghose und weit offenem Hemd eine heiße Sause ab, dass das Tanzparkett nur so dampft. Die beiden Groove-Monster singen über Love, Herzschmerz und ihr Glamour-Leben. Stimmen, so heiß wie Lava und weich wie das Bärenfell vor dem knisternden Kamin. Die beiden nehmen uns mit auf einen wilden Ritt, der die Hörer mit rollenden Drum-Fills, kaum zu bändigenden Trompeten und bouncenden Bässen atemlos zurücklässt. Gemeinsam mit ihren Background-Sängern schreien und stöhnen sich die beiden Stars ihren Weg durch das Album. Alles glänzt, schimmert und spiegelt sich in der Disco-Kugel, welche über dem Dancefloor scheinbar immer größer wird, bis es sich zu einem Raumschiff verwandelt, welches Richtung funkelnde Disco-Galaxie abhebt. Und eines ist sicher: Du willst auf diesem Trip dabei sein!
Anspieltipps: Fly As Me & Leave The Door Open
Benny Sings – Music
Der Wuschelkopf aus Holland lieferte uns in diesem Jahr ein Album wie eine Tafel Luftschokolade: Wenig Dichte, dafür aber leicht und süß. Der Pop-RnB-Jazz-Mix des 43-Jährigen klingt auch auf seinem achten Studioalbum „Music“ wie ein warmer Frühlingsnachmittag, an dem man sich das erste Mal im Jahr seinen Hoddie nur über die Schultern wirft. Diesmal begrüßt der Niederländer auf seiner Platte einige kreative Köpfe wie Mac DeMarco, Tom Misch, Emily King oder Cautious Clay. Dass er gut mit anderen Künstler·innen harmonieren kann, bewies Benny Sings schon auf so manchem Feature, wie „Loving Is Easy“ mit Rex Orange County oder „Apartment“ mit den Free Nationals. Bei mir landet fast jeder Song, bei dem Benny seine Finger im Spiel hat, in einer meiner Playlisten. Sein Signature-Sound mit hüpfendem Klavierspiel, zaghaften Vocals und smoothem Schlagzeug-Groove ist auch auf diesem Album wieder tonangebend und knüpft somit an das empfehlenswerte Vorgänger-Album „City Pop“ an.
Antilopen Gang – Geldwäsche Sampler 1
Die Antilopen sind zurück! Mit dem Antilopen Geldwäsche Sampler 1 gibt es endlich wieder
neues von der selbsternannten “wichtigsten Rapcrew Europas”. Politisch wie eh und je überzeugt
das Album, wenn man es sich so nennen lässt, mit neuen Tracks, aber auch diversen Coverversionen und Features.
Von Eigenkreationen wie “Auf sie mit Gebrüll”, oder der Namensgebenden “Antilopen Geldwäsche”
zu alten Klassikern. Mein Favorit: “Filmriss”. Eine melodische Pianoversion von der eigentlich alten,
schrammeligen Originalversion von Knochenfabrik, welche 1997 auf deren Album Ameisenstaat erschien.
Eine ungewöhnliche Sammlung von Der Antilopengang und Kollegen, welche das Ende von 2021 noch ein bisschen weniger
schlimm gemavht hat.
Anspieltipps: Mir kann nichts passieren & Auf sie mit Gebrüll
Russkaja – Russki Style
Von Russkaja gab es dieses Jahr zwar kein neues Album, dafür aber einige neue Singles.
Die meiner meinung nach beste: “Russki Style”. Dieser Song ist alles, was die ersten Alben von Russkaja austrahlten.
Eine geniale Mischung aus Metal, Rock und Skaelementen, gemischt mit einer ordentlichen Portion Russischer Folkelemente
Wer nicht weiß, wie man zu der Musik abgehen sollte, der schaut sich am besten die zahlreichen Musikvideos der Band auf Youtube an und holt sich dort Anregungen zur Eskalastion.
Perlenbacher Stadtmusikanten – Radlerhass
Wie jedes Jahr entstanden auch 2021 viele neue Sterne am Musikhimmel. Einer dieser Sterne sind für mich
die Perlenbacher Stadtmusikanten, die eigentlich aus Dresden kommen und um die sich viele Mythen ranken. Viel lässt sich dazu nicht sagen, außer: Bier gut! Radler schlecht!
Tolle Musik zum Exzess mit Gerstensaft und Co, für alle, die von Ballermann Musik blutende Ohren bekommen aber eher nichts.
Grüße an dieser Stelle an Anton, danke für den Hinweis!
Anspieltipps: Kraul mir die Wampe & Bierpolizei
Benny Sings – Music
Der rot-blonde Lockenkopf Benny Sings hat mit „Music“ sein achtes Studioalbum herausgebracht und fühlt sich pudelwohl in seinem Stil. Mit seinen Anfängen im Hip-Hop hat er sich inzwischen doch eher in einen entspannten Funk mit Lo-fi R&B-, Souljazz- und Discoelementen eingegroovet. Diese sympathische Kombination von 80er und 90er-Jahre Einflüssen mit einem modernen Touch hat ihm viele internationale Fans, sowie Kollaborationen mit Künstlern wie Mac DeMarco, Tom Misch, Mayer Hawthorne oder Rex Orange County beschert.
Benny’s Lieder leben von den groovy Basspuren und dem jazzigen Klavier, über denen seine expressive Stimme erklingt. Synthesizer, Schlagzeug und Harmonien machen den chilligen Retrosound komplett. Wie der Songtitel „Sunny Afternoon“ schon vermuten lässt, ist dieses Album am besten auf einem sonnigen Balkon mit einem kühlen Getränk zu genießen. Aber es eignet sich auch hervorragend, um entspannt durch die Straßen zu schlendern oder an einem Kanal entlangzuradeln. Wie es einem auch gehen mag, mit Benny Sings schafft man es garantiert, zur Ruhe zu kommen und mit einem Lächeln und wippendem Fuß in den Tag zu starten.
Oder wie Benny sagt: „It’s so easy to get overstimulated in the world today. We need light and air, we need something that energizes us.” Da ist “Music” perfekt, um auch mal abzuschalten.
dodie – Build A Problem
In diesem Album zeigt dodie mal wieder ihre größte Stärke: Nachvollziehbarkeit. Besonders für viele junge Erwachsene wirken die Texte der 26-jährigen Britin wie aus der Seele geschrieben, wenn es z.B. darum geht, sich selbst kennenzulernen und seine Identität zu finden oder um Sexualität und Beziehungen und wie das alles mit Kindheitstraumata zu vereinen ist.
Ihre Musik zeichnet sich durch raue Emotionen aus, die mit sanfter Stimme und vermeintlich simplen Melodien Gestalt annehmen. Durch engelsgleiche Harmonien und die begleitenden Streichinstrumente gewinnen ihre Lieder jedoch nach und nach an Komplexität. Jedes noch so simple Wort und jede Note wurden sorgfältig gewählt, um ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen. Insgesamt sorgt sie dadurch für ein bitter-süßes, melancholisches Album – was aber nicht heißt, dass dodie nur dem Klischee des „sad white girl“ entspricht. Songs wie „Hate Myself“, „Special Girl“ und „Boys Like You“ beweisen, dass sie aus schwierigen Thematiken durchaus auch Gute-Laune-Bops zaubern kann.
Nach den offiziellen 14 Songs des Albums hat die Sängerin noch acht Bonuslieder in einer zweiten Disc angefügt. Diese Demos entstanden während ALOSIA („a lot of songs in april”), einem Projekt während dessen dodie aller paar Tage ein Video mit einem neuen Songentwurf auf Youtube hochlud. Durch die ausführliche Dokumentation dieses Prozesses erlaubt die Britin ihren Zuhörer*innen einen noch intimeren Blick in ihre Gefühlswelt und ihren Schreibprozess. Auch beim Anhören sind diese Demos eine interessante Abwechslung, da sie so roh und unproduziert wirken.
Unamericana – The Other Favourites
Unamericana scheint auf den ersten Blick wie ein seltsamer Titel für das neueste Album von The Other Favorites. Das Duo, bestehend aus Joshua Lee Turner und Carson McKee, ist schließlich bekannt für ihren warmen, vertrauten Folk, Country und eben Americana-Sound. „Unamericana“ bezieht sich dann wohl, wie aus dem Titelsong erahnbar, eher auf den Versuch der Brooklyn-basierten Musiker, die eigene Kindheit in Amerika und die Liebe für amerikanische Musik mit der amerikanischen Geschichte und der aktuellen politischen Lage zu vereinbaren – beziehungsweise sich davon zu distanzieren. Mit poetischer Manier verarbeiten sie den Sturm auf das Kapitol in Washington in dem Song „Unamericana“. Auch Religion wird mehrfach thematisiert, angefangen beim christlichen Ferienlager, welches Josh Turner in „Jesus Horse Camp“ beschreibt.
The Holy Spirit chased me as a horsefly
Through a pretty summer Michigan day
(…)
Ooh, it’s all heaven sent
For the last week as a cowboy that I ever spent
Ooh, and we’re all hellbent
On living some American dream I can’t see
Musikalisch lässt sich allerdings nicht viel von dieser amerikanischen existentiellen Krise vermuten. Mich erinnern ihre Lieder immer an eine Holzhütte, in der man sich vor dem Kamin in eine warme Decke kuschelt und seinen Freunden beim Gitarrespielen lauscht. Die relativ einfachen Melodien werden häufig durch Harmonien ergänzt und laden geradezu zum Mitsingen ein. Auch das komplexe Fingerpicking, sowie Ausschmückungen und Soli der beiden talentierten Multiinstrumentalisten erwecken die Begleitung erst zum Leben. Für diejenigen, die das Duo mal in ihrem Element sehen wollen, haben sie eine komplette Aufnahme des Albums auf YouTube gestellt.
Dean Blunt – Black Metal 2
Ein paar wenige, fast hingeworfen wirkende, Zeilen, sparsamer Sampleeinsatz im Instrumentarium und einfache Melodien, die gekonnt düster-verkopfte Atmosphäre erzeugen. Das wäre das Rezept für Dean Blunts Black Metal 2. Aber was macht das Album zu meiner Nummer 1 im Jahr 2021?
Als Prankster und Weirdo hat sich Dean Blunt bereits einen soliden Ruf aufgebaut: Vom Verkauf Marijuana gefüllter Spielzeugautos auf Ebay bis zur gefaketen Annahme seines NME Awards 2015 durch ein Double hat der Experimentalmusiker die absurdesten Stunts gebracht. Die Musik steht dabei jedoch keineswegs hintenan: kreatives Sampling und die Synthese von Gitarrenspuren, Streichern und London-Hackneyer Streetcredibility haben Fans und Kritiker gleichermaßen immer wieder aufhorchen lassen.
Black Metal 2 ist das ersehnte Follow-Up zu dem 2014er Album Black Metal, das mittlerweile zum Szeneklassiker avanciert ist. Mit gerade mal 10 Tracks und einer Gesamtlänge von kaum mehr als 20 Minuten konzentriert sich das neue Album auf das Wesentliche: Weiche Melodien mit der für Hypnagogik Pop typisch verträumten low-fi Ästhetik. Der engelsgleiche Gesang Joanne Robertsons liefert den perfekten Kontrast für den hypnotischen Sprechgesang Dean Blunts. Trotz einfachster Mittel entsteht so ein musikalisch tiefes Soundbild, das Selbstgenügsamkeit und auch Innengekehrtheit kennzeichnen – Qualitäten, welche auch die Pandemie in diesem Jahr jedem zwangsläufig abverlangt hat.
Es braucht kein über-maßvolles Instrumentalvirtuosentum wie bei einer Fiona Apple, oder scharfes political commentary á la Kendrick Lamar. Ohne Schnörkel und Schnick-schnack geht Black Metal 2 direkt auf’s Ganze und trifft mit Wehmut, Tapferkeit und Resignation die Zeit der endlosen Pandemie.
Cities Aviv – The Crashing Sound of How it Goes
Ohne jegliches Instrumental erklingt eine Stimme. Wie von allem Weltlichen entfremdet. Beladen mit Echo- und Halleffekten. Die Worte sind zuerst kaum verständlich. Langsam formen sich die Vokale und Konsonanten in der Repitition zu den Zeilen „You touched my soul“ und „You pulled me in“. Es entsteht ein Gerüst, um das sich zufällig aufflackernde Samplefetzen organisieren. Dies alles schwillt an Intensität an, sinkt wieder herab und leitet in den ersten Track „Higher Up There“ ein. Inmitten der körperlosen Geräusche setzt eine vor Wärme und Seligkeit fast überquellende Melodie ein und kurz darauf der Rap Cities Avivs.
The Crashing Sound of How It Goes offeriert auf 26 Tracks und gut 70 Minuten einen bunten Blumenstrauß an smart katalysierten Einflüssen, Stimmungen und Rhythmen. Das effektorchestrierte Spiel mit desorientierenden Jazz-Interludes, sitzenden Soul- und Funk-Samples und abwechslungsreichem Rap verrennt sich jedoch keineswegs in der eigenen Verkopftheit.
In perfekter Abstimmung mit dem Instrumental geben die Vocals dem Gesamtbild zusätzlich Textur – mal durch hypnotische Repetition, mal durch Reimstruktur und starke Delivery. Dabei drängt sich der Rap nie in den Vordergrund, sondern unterstreicht vielmehr die Stimmung der Produktion. So wie die Musik vorangeht und die Vocals scheinbar assoziativ folgen, so führt die Musik auch den Hörer scheinbar blind durch das Album – wie sich die je nächsten Minuten entwickeln ist kaum vorhersehbar. The Crashing Sound… bietet hier viel Überraschungspotential: Idyllische Synthpassagen brechen abrupt auseinander zu Samplecollagen, die wiederum Soulschnipseln Raum zur Entfaltung geben. Diese Spontanität gibt The Crashing Sound… hohes Wiederhörpotential. Konzepte werden nicht totexerziert, wodurch kein Momentum verspielt wird.
Trotz der technischen Vielfalt steht das Album emotional mit beiden Beinen auf festem Boden. Nach drei bereits großartigen Projekten im vergangenen Jahr, findet Cities Aviv auf The Crashing Sound… den wohl schönsten und vielseitigsten Ausdruck seines genialen Eigenbrötlertums.
Anspieltipps: Mizuno & A Piece of Me
Lil Ugly Mane – Volcanic Bird Enemy and the Voiced Concern
Auf den ersten Blick ein idyllisches Bild: Ein Kind streckt seine Hand nach einer Eiskreme, die ihm aus einem Verkaufswagen gereicht wird. Picknickende Familien freuen sich über die letzten Plätze im Schatten der Mittagssonne und zwischen den Bäumen jagen sich ein paar Freunde bei Cowboy und Indianer. Aber irgendetwas wirkt nicht ganz richtig und seltsam verschoben. Man schaut genauer hin und erkennt, dass das Speiseeis mit Brechmittel gestreckt ist, sich die vermeintlichen Spielzeugpistolen als voll funktionsfähige Taserwaffen herausstellen und zu allem Überfluss die Sonne den Parkbesuchern in wenigen Sekunden die Haut von den Knochen brennt. Seltsamerweise jedoch lässt sich von diesen Umständen niemand beirren und auch die würgenden Kinder grüßen noch halbverbrannte Jogger, die gerade vorbeilaufen.
So, oder zumindest so ähnlich, klingt Volcanic Bird Enemy and the Voiced Concern, das erste Album von Lil Ugly Mane seit sechs Jahren: Ein lockerer Spaziergang durch die Hölle, der sich für keine Lächerlichkeit mehr zu fein ist. Unschuldige Kindermelodien zu hässlichstem Sardonismus.
Der aus Memphis stammende Musiker und Produzent ist vor allem für seine düster-abstrakten Beats und Texte berühmt, in denen es an Selbsthass, Gewalt und Misanthropie kaum genug sein konnte. Neben seiner Experimentier- und Samplefreude, ist Lil Ugly Mane, bürgerlich: Travis Miller, vor allem durch seine Fähigkeit, eine zutiefst bedrückende Atmosphäre aufzubauen zu einer der bekanntesten Figuren des Memphis-Rap geworden.
In diesem Sinne ist Volcanic Bird Enemy… ein großer Schritt in neue musikalische und stilistische Gefilde. Heitere Instrumentale mit Downtempo, Neo-Psychedelia und Trip-Hop Elementen sorgen für eine deutlich entspanntere Stimmung als auf früheren Projekten. Zudem wurde der Rap durch Gesang ersetzt, was überraschend gut funktioniert. „discard“, „headboard“ oder auch „vpn“ sind nur ein paar Beispiele für das nicht bescheidene Hitpotenzial des neuen Albums. Refrains, die sich festsetzen und die man auch an guten Tagen hören kann, sind keine Seltenheit auf Volcanic Bird Enemy…. Bei aller Veränderung wurde der experimentelle Einschlag nicht über Bord geworfen; Lil Ugly Mane überrascht auf diesem ohnehin aus der Reihe fallenden Album mit einer Vielzahl von Sounds, ausgefallenen Samples und Ideen, die überraschend ausgereift und gut integriert sind.
Den warmen und melodischen Instrumentals stehen häufig gegenläufige düstere Thematiken, wie Drogenabhängigkeit und Selbstverachtung gegenüber, ohne dabei je plakativ zu wirken. Selbst hinter den genuin schönen Momenten auf Volcanic Bird Enemy… lauert stets das Gefühl von Verschobenheit und Absurdität. Das neue Album stellt nicht nur Millers Vielseitigkeit als Produzent unter Beweis, sondern thematisiert Mental-Health beinahe humorvoll durch gut gesetzte Stilbrüche, jenseits der ‚Guten Miene zum Bösen Spiel‘, auf innovative Weise.
SPIRIT OF THE BEEHIVE – ENTERTAINMENT, DEATH
Über die ersten 60 Sekunden ihres dritten Albums sagt Sänger und Gitarrist Zach Schwartz, überstehe man sie, überstehe man auch den Rest des Albums. Und in der Tat führt die Mähdrescher-Massenkarambolage in „Entertainment“ recht bald in eine recht harmonisch-poppige Ordnung. Ausruhen sollte man sich auf diesen Ruheinseln aber nicht. Das Trio Schwartz, Rivka Ravede und Corey Wichlin scheinen sich zum Ziel genommen zu haben, die Malaise des modernen Menschen, das „Unbehagen in der Kultur“, in klangliche Formen zu gießen. Wieder Schwartz: „I love to give people anxiety because i don’t wanna be the only one who has it.“ Gewissermaßen erinnernd an die Expressionisten vor hundert Jahren, schildern sie recht eindrücklich die Misere des überforderten und hilflosen Ich inmitten einer immer hektischer und fordernderen Welt, die bestimmt ist von Reizüberflutung, einer permanenten Verfügbarkeit, einem nicht abreißenden erschöpfenden Immer-und-überall-Sein und Paranoia.
Anywhere that you go, they will find you
You might wait but you’re already in the future
Anywhere that you go, there’s a pulpit and a preacher
Anywhere that you go
Die Band aus Philadelphia illustriert das, wie könnte es anders sein, mit der Collage. Fragmente und Klangskizzen stoßen auf einander, sei es wie im exemplarischen „There’s nothing you can’t do“ das Sample einer Zahnpastawerbung, das in einen doch recht stringenten irgendwie bedrohlichen Rhythmus findet , in einem lauten, noisigen Crescendo aufplatzt um sich schließlich wieder in der Werbewelt wiederzufinden, oder aber in „I SUCK THE DEVILS COCK“, das den Flickenteppichstil auf die Spitze getrieben hat: Aus ursprünglich vier Songs wurde einer, die derartig unterschiedlich waren, das sie in der Komposition nicht mal auf eine gemeinsame Datei gepasst haben und für die Aufnahme gar unabhängig eingespielt werden mussten.
Die ständige Kurzweiligkeit von „ENTERTAINMENT, DEATH“, die unruhige kakophonische Schichtung und Verschiebung unstimmiger Medien, wird durch die Lyrics nur noch unterstrichen: Rivka Ravede gibt zu Protokoll, dass eigentlich all ihre Texte das Resultat eines stream of consciousness seien, die in sich aber in der Retrospektive doch grobes Narrativ offenbarten und auch dem losen Grundthema entsprächen.
I remember the promise of a future
Could it all be in my head?
Could the reaction be a godsеnd?
I made my bed, I’ll lie in it
I bit thе curb and all at once
Vision blurs, pressure rise
And then time becomes nothing
Bei aller fiebertraumhaften, horrortrippigen und allzu oft verstörenden Klang- und Bildästhetik ist es aber auch nicht allzu überraschend, dass Drogen wie LSD als Realitätsfluchtmittel auch einen gewissen Platz im Spirit of The Beehive Kosmos haben und gerne thematisiert werden, wie in „Wake up (in Rotation)“, wo ein harmlos erscheinender Ausflug in die Hosentasche in eine endlose Raumauflösung entgleist.
Man merkt, die Band hat einiges investiert um den bereits auf „Hypnic Jerks“ eingeschlagenen Weg der Genrelabel-Diffusion zu perfektionieren und sich von ihren Shoegaze- und Noiserock-Ursprüngen weitgehend zu lösen. Es ist ein detailversessenes, bisweilen zermürbendes, aber schlussendlich irgendwie belohnendes Gesamtwerk, das wenn man sich erst einmal drauf eingestellt hat, durchaus hörbar wird. Eher desillusionierte Resignation als Fundamental-Kapitulation, auch die Einsicht führt noch nicht zu Besserung. Musik ist dennoch ein veritables Surrogat, Drogen für so manche möglicherweise auch. Oder wie Schwartz sagt: „It’s good to be happy“.
Anspieltipp: SPIRIT OF THE BEEHIVE | Fender Sessions
black midi – Cavalcade
Black Midi haben den üblicherweise zermarternden Weg von einem Geheimtipp zu einer weltweit tourenden und gefeierten Größe ohne allzu große Umwege genommen. Warum es manche Bands schaffen und andere nicht, das ist eine der großen Menschheitsfragen. Black Midi indes werfen eher die Frage auf, ob sie wegen oder trotz ihrer Erwartungsverweigerung derartig schnell durch die Decke gegangen sind. Irgendein nebulöser Mythos liegt von Beginn an auf dieser Band, seit – ich schrieb es bereits in meiner 2019er Review zu „Schlagenheim“ – ich die Band das erste mal live gesehen hatte, auch wenn es letztlich nur die Hälfte des letzten Songs war, der wie ich später erfahren sollte bmbmbm hieß, weil ich mich zuvor verschnackt hatte und der Raum komplett überfüllt war. Dennoch hat mich, und wohl noch so einige andere, diese Band seither nicht mehr losgelassen. Aber genug des Pathos.
Die Band, mittlerweile nur noch bestehend aus Geordie Greep, Cameron Picton und der lächerlich überragende Schlagzeuger Morgan Simpson, seit Gitarrist und Teilzeitsänger Matt Kwasniewski-Kevin die Band aus persönlichen Gründen vorübergehend verlassen musste, entstammt zwar dem Brixton Windmill Milieu, hat mit den allermeisten Post-Punk-Bands des Hauses in Südlondon wie Squid oder Shame aber recht wenig gemein. Als wild-ungestüme freudig experimentierende und improvisationsaffine Jugendliche mit ein bisschen zu viel Musikwissen und postpubertärerem Hang zu einer gewissen Außenseiterarroganz, gehen sie selbst noch weiter als Black Country, New Road, mit denen sie sich sonst dennoch gerne zu Jams treffen. Viele der Songs auf Cavalcade haben im Vergleich zum Vorgänger aber keinen Jam-Charakter mehr, woran natürlich auch Covid und Lockdown ihren Anteil haben:
“There was alot of really different stuff, stuff we wouldn’t have done before, like tracks without drums or with very simple drum parts. It’s stuff we wouldn’t have been able to do as we wouldn’t have had the time to just sit in our bedrooms for weeks, normally.”
Bis dahin entwickelte sich die Musik mit jedem Auftritt weiter, immer wieder den gleichen Song in der gleichen Weise live zu performen schien unerträglich langweilig. Als das dann aber unmöglich wurde, waren andere Mittel gefragt. Es wurde nicht mehr im Proberaum durch die Wand drauf losgespielt, sondern tatsächlich komponiert, zumindest in weiten Teilen. Noch ausgeschlossen auf Schlagenheim: ein Song wie „Marlene Dietrich“, eine reduzierte Jazz-Ballade und einer der schönsten Songs des Jahres. Eine Liebeserklärung an die WWII-Schlagersängerin mit für Geordie Greep bis dato völlig ungewöhnlichem Stimmeneinsatz, nicht mehr Spoken word, sondern ein lobeshymnischer Scott Walker-Ton.
Songs wie „John L“ oder „Hogwash and Balderdash“ lassen einen hingegen zunächst verzweifeln, viel zu viel und zu schnell auf einmal, innerlich wächst beim erstmaligen Hören das Bedürfnis, diesen prätentiösen Bängeln das Schlimmste zu wünschen. Die durchaus bekannten hektischen Rhythmenverschiebungen, die steten sich türmenden Wiederholungen, die ständigen Brüche innerhalb der Stücke: Das gab es durchaus schon auf Schlagenheim, black midi haben ihr Spektrum nun aber noch einmal erweitert. Es sind nicht mehr nur die Math-Rock und Freejazz-Anleihen, die einem Schwierigkeiten bereiten könnten, auf Cavalcade wird man immer wieder wortwörtlich von Pferdestaffeln überritten. Der massive Einsatz von Bläsern, der sich den bereits völlig entfesselten Saiten anheimgesellt, und in vielen Momenten durchaus aus der Lunge eines Peter Brötzmann stammen könnte, zeigt auch eine Hinwendung zu Prog und Fusion der 70er wie King Crimson oder Frank Zappa. Das mit apokalyptischen Szenarien liebäugelnde „Slow“ vereint viele dieser neuen Tendenzen mit alten Mustern, die jagenden Akkordloops und Simpsons treibendes arhythmisches Drumspiel werden im Mittelteil gebrochen um in jazzfusionhafte Interludes zu gelangen und an anderer Stelle wieder ihr Unwesen zu treiben. Die Band wird ihrem Namen also auch weiterhin gerecht. Pitchfork schrieb: „Listening to Schlagenheim, it was easy to imagine black midi kicking out the jams in a basement somewhere. Now, the imagined setting is more like a Hieronymous Bosch painting, or a three-ring circus.“
Songs wie „Diamond Stuff“ und der 10-minütige Epilog „Ascending Forth“ lassen einen hingegen wieder mächtig aufhorchen und eher in Monets Seerosengärten träumen. Dass diese Songs, die eher an ein Kammerorchester, als eine junge Gitarrenband denken lassen, aus der gleichen Feder wie zuvor Erwähnte stammen sollen, würde man üblicherweise als „Hogwash and Balderdash“ abtun, nicht so bei dieser Truppe.
„The first record there was quite alot of compression. Emotionally as well, there’s alot more highs and lows (on Cavalcade, Anm. d. Red.). All the crazy bits are crazier and all the sweeter bits are way sweeter. It’s just a lot more.“
Aber auch literarischer und wortgewandter zeigt sich das Gespann, was sie bereits mit ihren eigenen Vertonungen von Guy de Maupassant, Ernest Hemingway u.a. angedeutet hatten. „John L“ (=der 50.) erzählt die Geschichte eines in Verruf geratenen Herrschers, der sein Gefolgsleute täuscht, machtsüchtig Unheil anrichtet und schlussendlich gerichtet wird. „Hogwash and Balderdash“ wiederum die Geschichte zweier entflohener Gefängsinsassen, das alles syntaktisch recht schwierig aber stilistisch elaboriert, behaupte ich mal.
Black Midi haben es geschafft dem Erwartungsdruck eines zweiten Albums schulterzuckend eine galante Abfuhr zu erteilen, nicht ganz ohne an Provokation und Rezeption zu denken, aber ihren musikalischen Instinkt nicht aus den Augen zu verlieren. Enjoy.
Anspieltipp: black midi – Full Performance (Live on KEXP at Home)
Dummy – Mandatory Enjoyment
Eine recht späte Entdeckung dieses Jahr: Dummy! Gutdünken kann man die LA-Truppe als Musiknerd-Band, als Plattennarren-Band, bezeichnen. Und auch wenn sie es bislang nicht so recht zugeben wollen: Hier steckt natürlich sehr viel Stereolab und Broadcast drin. Dem motorischen 90er Noise-Pop zum Trotz schöpft Dummy aber aus einer sehr weiten musikalischen Referenzwelt, Ambient-Legende Laraaji ist ein Name, den sie immer wieder fallen lassen neben allerlei weiteren eher obskureren Undergroundgrößen. Eigens dafür haben sie auf ihrem Bandcampprofil eine Liste und auf Spotify eine Playlist mit unbedingt zu hörenden Musiker*innen eingestellt.
Die beiden Welten der Avantgarde und des Pop zu verbinden, das hat sich die Band von der Westküste auf die Fahnen geschrieben. Repititive eingängige Popmelodien, simple Akkordfolgen, harsche Drone- und Noisespuren, die aber in immer neuen Kombinationen übereinander geschichtet werden sowie mehrstimmige aber Gesänge bilden die Grundrezeptur vieler Dummysongs. Darauf aufbauend wird dann rumavantgardiert. Ein Song wie „H.V.A.C.“ verliert sich nach einem nach UK Post-Punk anmutenden Start in einem nebulösen Schwebezustand, der nur vom unkoordinierten Schlagzeug im Hintergrund nicht den Boden völlig aus den Augen verliert, „Atonal Poem“ hingegen, der Closer, setzt erst ab der Hälfte überhaupt ein.
Dummy haben mit ihrer ersten LP nach den vorangegangen beiden EPs gute Karten darauf in manchen Kreisen einen gewissen Kultstatus zu erreichen, wie es mit musikgeschichtsbeflissenen Bands häufig der Fall ist, die sehr wohl ihrer Vorbilder kennen, aber sie nicht bloß kopieren, sondern einen eigenen Zugang finden und in, ja, postmoderner Manier daraus etwas neues schaffen. Warum das Album jetzt in meinen Top 3 gelandet ist? Es ist sicherlich nicht eines der drei besten Alben des Jahres, aber es entspricht meinen derzeitigen Hörgewohnheiten. Und darum gehts hier doch oder?
Ihre Deutschlandauftritte wurden nun erstmal leider abgesagt, im September sollten sie auf Nachfrage dann wirklich den Weg herfinden. Bis dahin:
Anspieltipp: Dummy – Full Performance (live on KEXP)
Novaa - She's a Rose
Weiterlesen
„I NEVER SAID THAT I WANTED YOU TO // SO DON’T PRETEND LIKE I APPROVED”
Mit diesen Worten beginnt das Album einer Frau, die mich im letzten Jahr zu Tränen gerührt und aufgerüttelt hat. Der Name dieser starken und inspirierenden Künstlerin, Sängerin und Produzentin ist Novaa – und ihr solltet ihn euch alle gut merken. Ihr Album „She’s A Rose“ strotzt vor Stärke durch Ehrlichkeit und ist eine stetige Erinnerung an die Wichtigkeit von Konsens. Ich schreibe oft, dass mich ein Album bewegt, aber ich glaube, ich habe selten so viel gefühlt und auch gelernt wie bei „She’s A Rose“ – und wir alle können noch SO viel lernen. Die Kunst als Bildungsweg sollte für uns eigentlich eine der zugänglichsten und einfachsten Kanäle zum Lernen sein, und doch ist es nicht üblich.
Der Auftrag von Novaas Album lautet ganz einfach zuhören. Nicht nur den Texten und der wunderbar sanften, klaren Stimme sollte man gut zuhören, sondern ganz allgemein. Ich glaube wir haben alle verlernt, wie man richtig zuhört (vielleicht konnten wir es auch noch nie) und dabei ist Raum zum Kommunizieren so wichtig für ein gesellschaftliches Miteinander. „She’s A Rose“ ist kein Album für den Hintergrund oder für eine Beschallung, der man keine weitere Beachtung schenkt. Es ist ein Album, welches sich leise und trotzdem stark (denn nur weil man nicht laut ist, heißt das nicht, dass man nichts zu sagen hat) in den Vordergrund drängt und dort auch gehört werden sollte. Jeder Text gibt dem Zuhörenden die Möglichkeit mehr in den Kopf von anderen Personen einzutauchen, die eigene engstirnige Perspektive zu verlassen und anderen Sichtweisen die Chance zu geben, gesehen zu werden. Die Eigentherapie von Novaa wird so zur Therapiemöglichkeit für alle Zuhörenden und gibt Hoffnung auf Heilung.
Die Bedeutung der gesungenen Worte spiegelt sich auch in der musikalischen Inszenierung des Albums wider. Ein ruhiger, tragender und wohl überlegter Elektro-Pop-Sound unterstreicht und ummantelt den Fokus, der auf der Stimme liegt. Mit liebevoll eingeflochtenen Details bastelt er zu jeder Geschichte die passende Atmosphäre. Trotz Effekten wird nicht versteckt, welche Schönheit und Zerbrechlichkeit der Klang von Novaas Stimme mit sich bringt. Der Gesang trägt das Album und die Schwere der Worte auf seinem Rücken und auch ihm wird der nötige Raum gegeben, sich zu entfalten und sichtbar zu machen.
Der Kampf um Sichtbarkeit kann sowohl auf der Ebene der Musikbranche sowie auf persönlich/ gesellschaftlicher Ebene ausgefochten werden. Das Album macht klar, Novaa ist mitten in der Schlacht. Und sie kämpft weder allein noch für sich allein – sie kämpft für viele andere Menschen mit. Auch wenn das Album persönliche Geschichten erzählt, sollte klar sein, dass all diese Dinge, all dieser Selbsthass, sexuelle Gewalt, Unterdrückung, Abschied nehmen, Gefühle verstehen und ertragen sowie Übergriffe aller Art keine Einzelfälle sind. Novaa singt und musiziert für eine Gruppe von Personen, denen das Leben in unserer Gesellschaft unnötig schwer gemacht wird und die noch lange keine Aussicht auf Gleichberechtigung haben. Das alles macht es so wichtig diesem Album und allen anderen Geschichten und Menschen Gehör zu schenken. Seht nicht weg und mischt euch nicht ungefragt ein, sondern gebt manchmal einfach Raum zum Erzählen – das ist meine Bitte an euch. Und natürlich hört euch dieses fantastische, kluge und emotionale Album an.
„I’M NOT TRYING TO BE COOL HERE (…) I’M JUST TRYING TO SURVIVE THE INTENSITY OF EMOTIONS THAT I FEEL.”
Anspieltipps: “This Ain’t Your Home”, “Audre” & “Life ist Quiet”